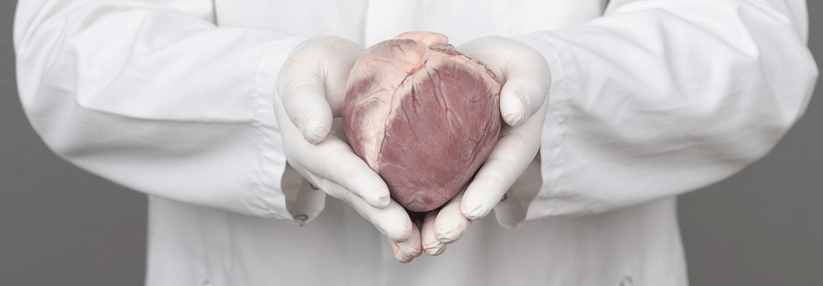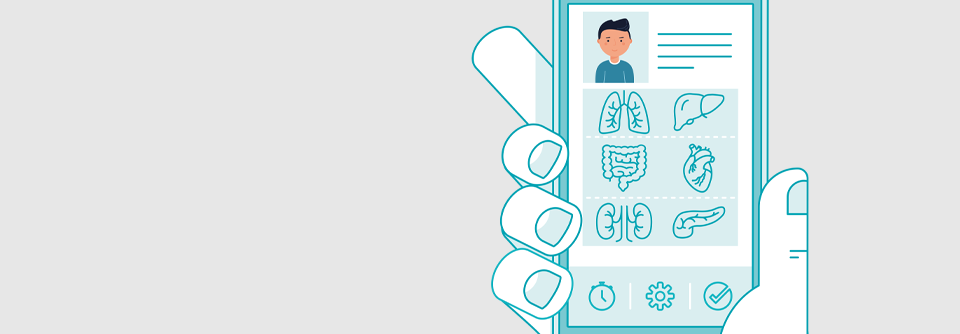Organspende: Hausärztliche Beratung statt Widerspruchslösung?
 Im Herbst stimmt der Bundestag darüber ab, ob für die postmortale Organentnahme weiterhin eine Zustimmung benötigt wird.
© iStock/sturti
Im Herbst stimmt der Bundestag darüber ab, ob für die postmortale Organentnahme weiterhin eine Zustimmung benötigt wird.
© iStock/sturti
Rund 10 000 Menschen warten in Deutschland aktuell auf ein Herz, eine Leber, eine Niere, eine Lunge, ein Pankreas oder einen Dünndarm. Im letzten Jahr spendeten jedoch nur 955 Menschen postmortal Organe – und das ist der Höchststand seit 2012. Die Gründe für die wenigen Spenden sind bekannt: Relativ wenige Menschen besitzen einen Spenderausweis, der Hirntod kommt nur selten vor und die Rahmenbedingungen in den Kliniken erlauben die Entnahme teilweise nicht.
Große Mehrheit der Deutschen findet Organspende gut
Dabei ist die Spendenbereitschaft der Deutschen in der Theorie hoch. Laut einer Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stehen 84 % der 14- bis 75-Jährigen der Organspende prinzipiell positiv gegenüber. Einen Spenderausweis haben jedoch nur 36 % ausgefüllt.
Für die Parteien im Bundestag scheint außer Frage zu stehen, dass eine prinzipiell positive Einstellung zur Organspende mit einer tatsächlichen Bereitschaft zur Spende einhergeht. Sie diskutieren, wie die Lücke zwischen Befürwortern und tatsächlichen Spendern geschlossen werden kann. Zur Debatte stehen zwei Gesetzesentwürfe fraktionsübergreifender Gruppen.
Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Professor Dr. Karl Lauterbach (SPD) und weitere Abgeordnete plädieren für eine doppelte Widerspruchslösung. Jeder Bürger ab 18 Jahre, der nicht aktiv widerspricht, gilt nach dann als Organund Gewebespender. Begründet wird die Lösung mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit: „95 % sagen, sie würden im Zweifel ein Organ annehmen, wenn sie schwer krank sind. Wenn das die Regel ist, kann ich doch auch erwarten, dass die breite Mehrheit dann auch bereit ist, ein Organ zu spenden“, erklärte Dr. Georg Nüsslein (CSU) im Bundestag. Prof. Lauterbach und Spahn argumentieren, man wolle die Menschen dazu bringen, sich mit der Frage der Organspende auseinanderzusetzen.
Auch Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, spricht sich klar für die Widerspruchslösung aus. In seinen Augen ist sie der einzige Weg, die Spenderzahlen deutlich zu erhöhen. Es sei zumutbar, eine Entscheidung zu verlangen, falls nötig auch von den Angehörigen der Verstorbenen.
Der Entwurf sieht vor, dass die Erklärungen der Bürger zur Organspende in ein Register eingetragen werden. Die für die Entnahme verantwortlichen Ärzte sollen darin einsehen können, ob ein Verstorbener der Spende widersprochen hat. Außerdem müssen Ärzte bei den Angehörigen erfragen, ob der Wille des potenziellen Spenders bekannt ist. Personen, die nicht in der Lage sind, die Tragweite einer Organspende zu erfassen, sind als Spender ausgenommen.
Von vielen Seiten werden ethische und rechtliche Bedenken gegen die Widerspruchslösung erhoben. Vor allem wird diskutiert, inwieweit sie dem Recht auf freie Selbstbestimmung entspricht. Angezweifelt wird auch, ob ein fehlender Widerspruch automatisch als Ergebnis einer aktiven Auseinandersetzung mit dem Thema interpretiert werden kann: „Es kann doch nicht sein, dass wir nach der Datenschutzgrundverordnung der Veröffentlichung eines Bildes im Internet positiv zustimmen müssen und bei der Widerspruchslösung, bei der es sich doch um eine ganz persönliche Entscheidung handelt, Schweigen als Zustimmung gelten soll“, sagte Christine Aschenberg-Dugnus (FDP). Insgesamt besteht die Befürchtung, eine Widerspruchslösung könnte postmortal Menschen zu Organspendern machen, die dies nie sein wollten.
Bedenken dieser Art bewegten eine zweite fraktionsübergreifende Gruppe rund um die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock dazu, einen eigenen Gesetzesentwurf zu formulieren. Nach diesem soll eine Organentnahme weiterhin nur mit dem aktiven Einverständnis des Spenders erfolgen. Allerdings sollen die Menschen öfter mit der Frage der Spende konfrontiert werden. So ist vorgesehen, dass in Ausweisstellen – beispielsweise bei Aushändigung des Personalausweises – auf die Möglichkeit zur Spende hingewiesen wird.
In der Beratung sollen Hausärzte eine zentrale Rolle spielen. „Etwa ein Viertel der Versicherten wünscht sich eine Beratung durch ihren Arzt oder ihre Ärztin. Diesem Beratungsbedarf müssen wir nachkommen, um die Menschen zu einer selbstbestimmten und freiwilligen Entscheidung zu befähigen“, erklärte Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen). Nach dem Entwurf sollen Hausärzte ihre Patienten alle zwei Jahre in einem extrabudgetär vergüteten Gespräch zur Organspende beraten und sie zum Eintrag in ein zentrales Online- Register ermutigen. In diesem sollen alle Bürger jederzeit ihre Spendenbereitschaft erklären und auch widerrufen können. Hausärzte wie auch Patienten sollen umfassend über die Spende aufgeklärt werden.
Bedingungen in Kliniken geraten aus dem Fokus
Die Kritiker der Zustimmungslösung bezweifeln, dass eine regelmäßige Erinnerung der Bürger reicht, um die Zahl der Spender zu erhöhen. Sie sehen in dem Entwurf die Fortführung des aktuellen Konzepts. Die Abgeordneten werden voraussichtlich im Herbst über die Gesetzesentwürfe abstimmen – ohne Fraktionszwang.
In der lebhaften Debatte um die Organspende wird immer wieder bemängelt, dass die geringe Zahl der Spendenwilligen nicht das entscheidende Problem sei. Vielmehr müsse man die fnanziellen und organisatorischen Strukturen in den Entnahmekliniken verbessern. Es wird argumentiert, dass auch in Spanien, dem Musterland der Organspende, erst verbesserte Rahmenbedingungen zu einer höheren Zahl von Spenderorganen führte. Im spanischen Gesetz steht eine Widerspruchslösung, praktiziert wird allerdings eine Zustimmungslösung.