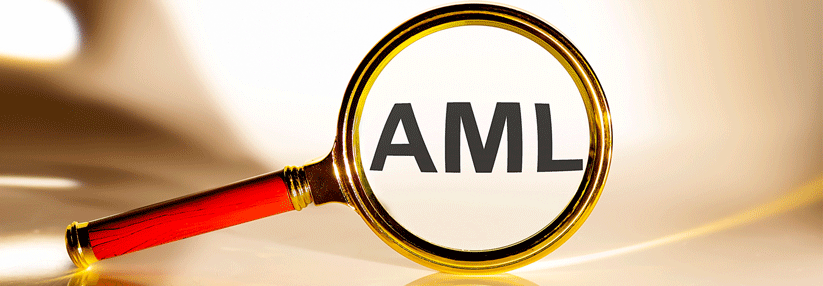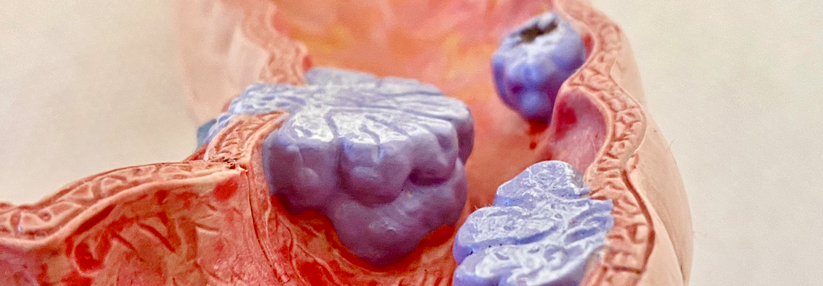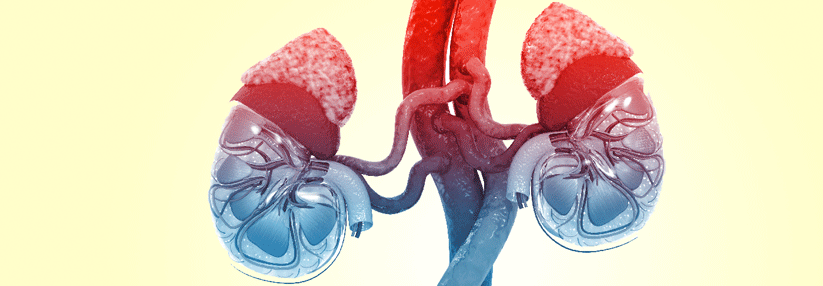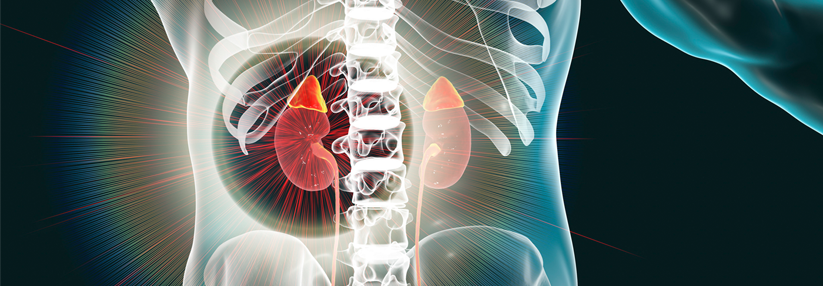
Patienten mit sehr hohem Risiko standardmäßig screenen
 Ein standartmäßiges Screening von Patient:innen mit sehr hohem Risiko, könnte dazu beitragen, dass eine Aldosteronüberproduktion öfter erkannt wird.
© SciePro – stock.adobe.com
Ein standartmäßiges Screening von Patient:innen mit sehr hohem Risiko, könnte dazu beitragen, dass eine Aldosteronüberproduktion öfter erkannt wird.
© SciePro – stock.adobe.com
Bei etwa 5–20 % der Hypertoniker liegt eine reninunabhängige Überproduktion von Aldosteron zugrunde. Ein primärer Hyperaldosteronismus entwickelt sich meist durch ein aldosteronproduzierendes Adenom oder eine bilaterale Hyperplasie der Nebennierenrinde. Seltenere Ursachen sind entsprechende Karzinome oder genetische Faktoren. Häufig wird angenommen, dass sich die Patienten mit einer Störung des Kaliumhaushalts präsentieren. Tatsächlich ist dieser aber meistens unauffällig: Nur jeder Dritte entwickelt eine Hypokaliämie, schreiben Prof. Dr. Prerna Dogra und Kollegen der Mayo Clinic in Rochester.
Schwerwiegende Folgeschäden sind häufig. Im Vergleich zu Menschen mit einer primären Hypertonie leiden die Betroffenen ungefähr 3,5-mal so oft an Vorhofflimmern, ihr Risiko für einen Schlaganfall ist mehr als verdoppelt. Linksventrikuläre Hypertrophie, Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit und Nierenfunktionsstörungen treten ebenso gehäuft auf wie ein Diabetes mellitus oder ein metabolisches Syndrom.
Die frühzeitige Diagnose ist Ziel eines strukturierten Screenings, das bei Patienten mit hohem Risiko für einen primären Hyperaldosteronismus durchgeführt werden sollte. Solch ein hohes Risiko besteht bei
- persistierender Hypertonie mit Druckwerten konstant über 150/100 mmHg an drei verschiedenen Tagen,
- Blutdruckwerten > 149/90 mmHg trotz Einnahme von drei oder vier Hypertensiva (inkl. eines Diuretikums),
- Hypertonie bei bekanntem renalem Inzidentalom, mit Hypokaliämie oder Schlafapnoe oder
- familiärer Belastung.
Beim Screening steht häufig das Aldosteron-Renin-Verhältnis im Fokus, denn die verstärkte Aldosteronproduktion verläuft reninunabhängig bei gleichzeitiger Reninsuppression. Der Quotient hat jedoch nur eine begrenzte Aussagekraft und keinen klaren Grenzwert, warnen die Autoren. Sie empfehlen, sich vielmehr einzeln auf das Aldosteron und das Renin im Plasma zu konzentrieren. Der Test ist demnach positiv bei einer Reninaktivität von < 1 ng/ml/h oder einem Gesamtreninwert unterhalb der Referenzgrenze bei erhöhtem Aldosteron (≥ 10 ng/dl).
Dreitägiger Suppressionstest zur Bestätigung
Geeignet für das Screening bei normokaliämischen Patienten, die sich nicht salzarm ernähren, ist eine morgens entnommene Blutprobe. Im Idealfall sollte der Patient alle auf das Renin-Aldosteron-System wirkenden Medikamente vier Wochen zuvor abgesetzt haben. Diese Vorgehen könnte ihn allerdings gefährden. Prof. Dogra und Kollegen empfehlen daher, die Therapie beizubehalten. Zur Bestätigung des Ergebnisses präferieren die Wissenschaftler einen Aldosteronsuppressionstest mithilfe einer dreitägigen salzreichen Diät und Auswertung des anschließenden 24-Stunden-Urins.
Bei einem positiven Test erfolgt die Überweisung zum Facharzt für die weitere Diagnostik. Eventuell kann ein Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (MR-Antagonist) eingesetzt werden, um die Wartezeit zu überbrücken, schreiben die Experten. Ausschlaggebend für die Therapie ist vor allem, ob sich ein unilaterales Adenom entdecken lässt oder ob es sich um einen bilateralen Prozess der Nebennierenrinde handelt.
Die Bildgebung bleibt diagnostisch oft uneindeutig, sie kann allerdings bei der OP-Planung helfen. Besser geeignet scheint die invasive Blutabnahme aus jeder Nierenvene zur Bestimmung eines evtl. unterschiedlich hohen Aldosterongehalts. Sie steht allerdings aufgrund der dafür erforderlichen Expertise meist nur in spezialisierten Kliniken zur Verfügung und sollte nur bei potenziellen OP-Kandidaten erwogen werden.
Im Falle eines einseitigen Prozesses entfernt man die betroffene Nebennierenrinde. Postoperativ erfolgt eine regelmäßige Kontrolle der Kaliumwerte über vier Wochen. Der Blutdruck stabilisiert sich meist innerhalb von einem bis drei Monaten, schreiben die Kollegen. Wichtig ist eine sorgfältig angepasste antihypertensive Therapie. Studien zufolge stellt sich bei insgesamt 37 % der Betroffenen eine Normotonie ein, bei knapp der Hälfte eine Verbesserung der Blutdruckwerte. Der Operationserfolg im Hinblick auf normale Kalium- und Aldosteronwerte liegt bei 94 %. Jüngere Patienten mit frühzeitiger Therapie haben die besten Heilungschancen.
Kommt eine OP nicht infrage oder handelt es sich um eine bilaterale Veränderung, fällt die Wahl auf MR-Antagonisten. Weniger Nebenwirkungen als Spironolacton hat Eplerenon, dieses kann aber nur off label verwendet werden und ist auch deutlich weniger wirksam. Zu den alternativen MR-Antagonisten gehören das bei diabetischer Nierenfunktionsstörung zugelassene Finerenon und das in Japan verfügbare Esaxerenon. In ersten Studien hat sich der neue selektive Aldosteronsynthesehemmer Baxdrostat als effektiv erwiesen.
Nierenfunktionsstörung kann demaskiert werden
Das Outcome einer Therapie ist meist positiv. Die Behandlung kann eine bereits bestehende Nierenfunktionsstörung demaskieren – zuvor getarnt durch die glomeruläre Hyperfiltration. In diesen Fällen kommt es vorübergehend zu einer reduzierten GFR und zu einem Anstieg der Kreatininwerte nach Therapiebeginn. Meist verbessern sich diese Werte innerhalb von drei bis sechs Monaten postoperativ oder nach Optimierung der Medikation.
Quelle: Dogra P et al. Mayo Clin Proc 2023; 98:1207-1215; DOI: 10.1016/j.mayocp.2023.04.023
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).