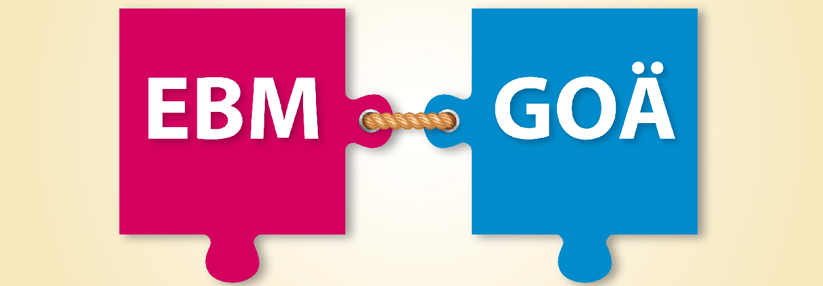
Misserfolg kostete Arzt die Hände – auf der Suche nach einem modernen Vergütungssystem
 Damals wurden Ärzte an ihrer Behandlungsqualität gemessen – und bei Fehltritten körperlich bestraft. Heute gibt es unterschiedliche Standards.
© Gina Sanders – stock.adobe.com
Damals wurden Ärzte an ihrer Behandlungsqualität gemessen – und bei Fehltritten körperlich bestraft. Heute gibt es unterschiedliche Standards.
© Gina Sanders – stock.adobe.com
Bei Heilung eines „freien Mannes“, also eines Vertreters des oberen Standes, sollte der Doktor zehn Silbermünzen erhalten. Der Plebejer zahlte für seine Kurierung fünf Silbermünzen. Für die Behandlung des Sklaven musste der Herr zwei Silbermünzen hingeben. Verstarb ein Begüterter durch die Behandlung mit dem „Metallmesser in Wunden oder einem Tumor“ oder wurde dessen Auge zerstört, sollten dem Medicus die Hände abgehackt werden. Der Sklave war zu ersetzen.
Nachzulesen ist das an einer Stele aus dem 18. Jahrhundert v. Chr., auf der die Rechtsordnung des babylonischen Königs Hammurapi wiedergegeben ist. Andreas Grabowski, Referent für GKV-Finanzierung und ambulante Vergütung im Bundesgesundheitsministerium (BMG), sieht darin ein Beispiel für obrigkeitliches Festlegen von Preisen für die ärztliche Behandlung – samt Ergebnisorientierung und Qualitätssicherung.
Quartalsabrechnung geht auf ein Gesetz von 1883 zurück
Im Lauf der Jahrhunderte folgten weitere Regelwerke, wie Grabowski darlegt. Im deutschen Raum erließen einzelne Städte ab dem 16. Jahrhundert Medizinalordnungen, den Berufszugang und die Vergütung betreffend. Getrennt wurde in Ärzte und Wundärzte. Einzelne Leistungen wurden mit Preisen hinterlegt, auch Steigerungssätze je nach Beschaffenheit der Wunde gab es schon.
1897 folgte die Preugo, die neue Preußische Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte – Vorgänger der heutigen GOÄ. Anfang des 20. Jahrhunderts gründeten sich auch die ersten Interessenverbände der Mediziner wie der Hartmannbund, um Ärzte bei Vertragsverhandlungen mit Kassen zu unterstützen. Das Krankenkassenwesen hat laut Grabowski seinen Ursprung in der Unterstützung für Handwerkerzünfte. Nach deren Niedergang verblieben Hilfs- und Unterstützungskassen.
1883 sei dann mit dem „Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter“ der Grundstein für die gesetzliche Krankenversicherung gelegt worden. Von da an bestand auch die Wahl zwischen Primärkasse (KVG) und Ersatzkasse (Hilfskasse). Die Berechnung der Kosten für die Behandlung wurde auf ein Quartal bezogen, deshalb auch das heutige Quartalsprinzip bei der Abrechnung.
Die PKV ist zurückzuführen auf das ab 1901 geltende „Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmen“. Mit diesem wurden auch die Ersatzkassen Teil der PKV. 1934/37 erfolgte jedoch die Rückeingliederung derselben in die gesetzliche Krankenversicherung. Rund 20 000 Krankenkassen gab es damals, mit im Schnitt 170 Versicherten, wie Grabowski ausführt: „Ein schwerer Fall hat eine Kasse schon in Bedrängnis bringen können.“
1931 konstituierten sich die ersten Kassenärztlichen Vereinigungen – Ausgangspunkt für die ersten kollektivvertraglichen Regelungen, für einheitliche Zulassungsregelungen und die freie Kassenarztwahl für Kassenpatienten. Budgetierte Gesamtvergütung, Honorarverteilungsmaßstab und Punktwerte nach Preugo wurden der Abrechnung zugrunde gelegt. Das zeige, „die Geschichte der privat- und kassenärztlichen Versorgung in Deutschland ist eng miteinander verwoben“, so Grabowski. Er leitete die Geschäftsstelle der „Wissenschaftlichen Kommission für ein modernes Vergütungswesen (KOMV)“. Sein Vortrag war der Auftakt einer Veranstaltung in Berlin zur Arbeit der vom BMG beauftragten Expertenkommission.
Einheitsgebührenordnung ist vom Tisch – oder nicht?
13 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen berieten mehr als ein Jahr, wie ein modernes Vergütungssystem aussehen könnte. Im Januar legten sie den Abschlussbericht vor. Fazit der KBV: Eine einheitliche Gebührenordnung für PKV und GKV birgt mehr Nachteile als Vorteile, die Einheitsgebührenordnung ist vom Tisch. Ganz so eindeutig wollen es die Kommissionsmitglieder nicht verstanden wissen. Sie haben schließlich für GKV und PKV ein gemeinsames Fundament ausgearbeitet – wie bei einer Doppelhaushälfte, so Ökonomie-Professorin Dr. Leonie Sundmacher, München.
Die Frankfurter Jura-Professorin Dr. Astrid Wallrabenstein erläuterte dieses: Zuerst müsste eine gemeinsame Leistungslegendierung erfolgen, durch einen gemeinsamen Leistungsausschuss, dem GKV-Spitzenverband, KBV, PKV-Verband und Bundesärztekammer angehören. Ein gemeinsames Institut könnte dann die Kosten kalkulieren, z.B. für Komplexe und Pauschalen.
Thema nur angepackt, weil es im Koalitionsvertrag steht
Danach erfolge das Inrelationsetzen der Leistungen zueinander – im GKV-Bereich durch den Bewertungsausschuss, im PKV-Bereich durch einen Vergütungsausschuss (gibt es noch nicht). Als Letztes komme die Preisfestsetzung auf regionaler Ebene (GKV) bzw. im individuellen Vertrag (PKV).
Die Veranstaltung zeigte allerdings, dass viele Fragen, u.a. zur Patientensteuerung, unbeantwortet blieben. Das liege am begrenzten Arbeitsauftrag der KOMV, aber auch an grundsätzlichen Problemen, hieß es. Die Steuerung von Patienten im ambulanten Sektor sei „etwas, was wir nicht anfassen – trotz wirklich sehr hoher Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen in Deutschland“, so Prof. Sundmacher. Ein Vergütungssystem allein werde deshalb keine sinnvolle Steuerung hinsichtlich einer besseren Prozess- und Ergebnisqualität ermöglichen.
Auch über mögliche Qualitätsvorgaben in der GOÄ hatten die Expperten gesprochen. Die Diskussion sei jedoch abgebrochen worden, weil es sich um Länderrecht handelt, so Prof. Wallrabenstein. Sie geht davon aus, dass bei Übernahme des GKV-Standards durch PKV und Beihilfe viele der Praxen schließen müssten, weil sie Vorgaben nicht erfüllten.
Will das die Politik riskieren? Wohl kaum. Einer der Professoren im Publikum bezeichnete die Arbeit der Honorarkommission als „Feigenblattgeschichte“. Das Thema wäre doch nur deshalb angepackt worden, weil es im Koalitionsvertrag stehe.
Quelle: Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht – Tagung zur Ärztevergütung




