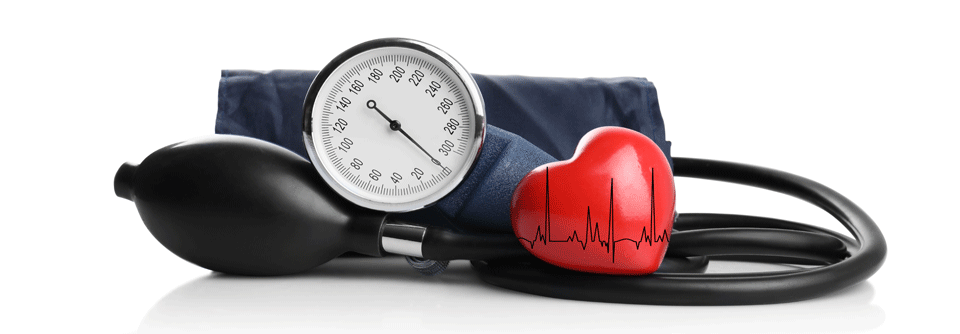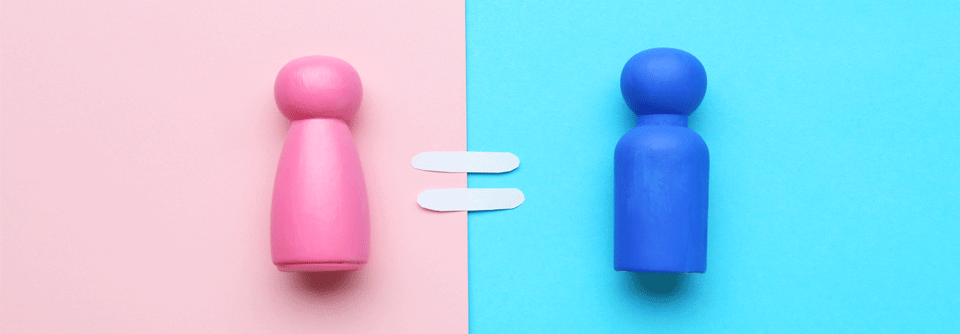Krebserkrankungen Das Yin und Yang der Geschlechterunterschiede
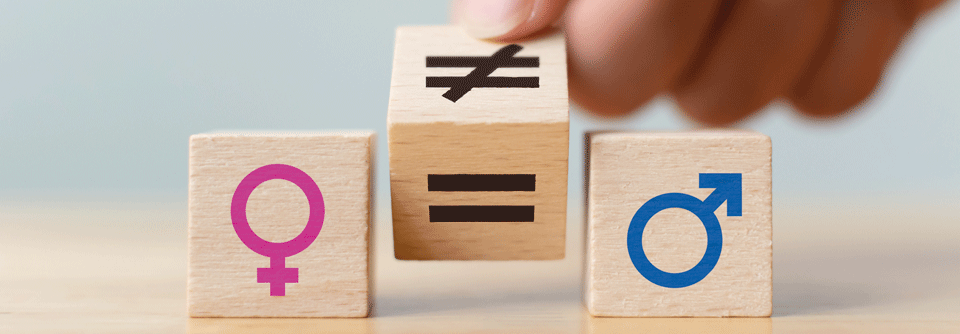 Eine geschlechtsspezifische Betrachtung und Behandlung von Krebserkrankungen lohnt sich.
© Monster Ztudio – stock.adobe.com
Eine geschlechtsspezifische Betrachtung und Behandlung von Krebserkrankungen lohnt sich.
© Monster Ztudio – stock.adobe.com
Initiativen wie die ESMO Gender Medicine Task Force und der Arbeitskreis Diversitäts- und Individualmedizin in der DGHO, in denen Sie federführend aktiv sind, haben geholfen, dass die Gendermedizin auch in der Onkologie angekommen ist. Wie kam es dazu?
Prof. Dr. Anne Letsch: Die Erkenntnisse aus anderen Fachbereichen, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, haben inzwischen auch in der Onkologie den Blick dafür sensibilisiert. Wir haben Daten, die das untermauern und uns motivieren, weiter dazu zu forschen.
Wenn man die Daten zunächst auf die (molekular-)biologische Ebene beschränkt, was sind wichtige Geschlechterunterschiede?
Prof. Letsch: Es beginnt bei den Geschlechts-Chromosomen. Frauen haben zwei X-Chromosomen, auf denen auch Tumorsuppressor-Gene verortet sind, welche die Entartungs-Wahrscheinlichkeit von Zellen im Körper unterdrücken können. Wenn sich ein solches Tumorsuppressor-Gen durch Mutation oder äußere Einflüsse verändert, haben Frauen immer noch das „intakte“ Gen auf dem zweiten X-Chromoson, das theoretisch als Schutz dient.
Bei Männern ist das anders. Sie haben keine „Ersatzkopie“, sondern „nur“ noch das Y-Chromosom, das möglicherweise die entsprechende Schutzfunktion nicht bieten kann. Dieser Mechanismus ist vermutlich mitverantwortlich, dass Tumoren bei Männern tendenziell etwas häufiger auftreten als bei Frauen. Zudem liegen auf dem Y-Chromosom Gene, die die Entstehung von Krebs fördern können. Zudem gibt es die Einflüsse der Geschlechtshormone, die sekundär das Immunsystem beeinflussen können und somit potenzielle Triggerfaktoren sind.
Können Sie wichtige Gender-Unterschiede schildern, die in der Onkologie eine Rolle spielen?
Prof. Letsch: Gender oder das soziokulturelle Geschlecht beinhaltet Verhaltensnormen, die auf Männer und Frauen in der Gesellschaft angewendet werden. Das beeinflusst Faktoren wie Ernährung, Tabakexposition, Alkoholkonsum oder die Wahl geschlechtertypischer Berufe, die zu einer höheren Noxenexposition führen können. Diese beeinflusst wiederum potenziell die Mutationsrate, was sich vielfach in einer erhöhten Tumormutationslast bei Männern zeigt.
Nun argumentieren manche, das die Entwicklung der Präzisionsmedizin, die Stereotype Geschlecht und Gender überflüssig macht. Ich glaube jedoch, dass sich beide Ansätze – Präzisions- und geschlechtersensible Medizin – letztlich ergänzen. Denn die Erkenntnisse der Präzisionsmedizin können uns helfen, die Mechanismen hinter den Geschlechts- und Gender-Unterschieden besser zu verstehen – und umgekehrt.
Wie beeinflusst das Geschlecht epidemiologische Zahlen und Outcome-Parameter in der Onkologie?
Prof. Letsch: Betrachtet man die Inzidenzen, gibt es ungefähr 20 % mehr Tumorerkrankungen bei Männern als bei Frauen. Das kann jedoch für die einzelnen Entitäten sehr unterschiedlich sein. Man sieht, dass manchmal eher genetische Faktoren eine Rolle spielen und manchmal eher genderassoziierte Faktoren.
Und dann ist vieles komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Beim Lungenkarzinom zum Beispiel nimmt seit einiger Zeit die Inzidenz bei Frauen deutlich zu. Die Annahme, dieser Anstieg sei auf den steigenden Anteil rauchender Frauen zurückzuführen, scheint jedoch nur die „halbe Wahrheit“ zu sein. Denn es zeigt sich, dass sich Lungenkrebs-Erkrankungen zwischen Männern und Frauen auch in ihrer Biologie und in ihrer Prognose unterscheiden.
Inwiefern beeinflusst das Geschlecht die Wirkung wichtiger Therapieformen?
Prof. Letsch: Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen tendenziell etwas besser von chirurgischen Eingriffen profitieren als Männer und dass auch postoperative Entzündungsreaktionen zum Teil bei den Frauen stärker ausgeprägt sind. Solche Unterschiede mitsamt ihren Ursachen und Folgen muss man jedoch für jede einzelne Tumorentität detailliert analysieren.
Dann gibt es Krebsentitäten, wie Kopf-Hals-Tumoren, die – wenn sie Frauen betreffen – besser auf eine Bestrahlung ansprechen. Das gilt auch für einige Chemotherapeutika, bei denen Frauen etwas stärkere Effekte entwickeln als Männer. Allerdings treten bei ihnen unter verschiedenen Chemotherapeutika häufig auch mehr und stärkere Nebenwirkungen auf als bei Männern.
Auch einige zielgerichtete Therapien, wie eine EGFR-Inhibition beim NSCLC, scheinen bei Frauen effektiver zu sein. Dies könnte darin mitbegründet sein, dass der EGFR-Weg bei Frauen eine größere Rolle in der Tumorentstehung spielt.
Was ist bei Immun- und CAR-T-Zell-Therapien in puncto Geschlechter-Unterschiede wichtig?
Prof. Letsch: Das Immunsystem von Frauen und Männern unterscheidet sich, ein Charakteristikum ist zum Beispiel das gehäufte Auftreten von Autoimmunerkrankungen bei Frauen. Betrachtet man die Checkpoint-Inhibition in Bezug auf geschlechterspezifische Aspekte, ergibt sich bislang ein heterogenes Bild: Zum Teil belegen Studien, dass Frauen schlechter auf CPI ansprechen, möglicherweise weil die Immunsuppression um den Tumor herum bei Frauen weniger stark ausgeprägt ist als bei Männern.
Eine andere Erklärungsmöglichkeit ist die bereits erwähnte höhere Mutationslast der Männer, die dafür sorgt, dass Tumorzellen durch das Immunsystem besser erkannt werden, und somit das etwas bessere Outcome von Männern unter einer Immuntherapie erklären könnte.
Insgesamt fehlen Daten zu geschlechterabhängigen Aspekten der Immuntherapie. Das gilt auch für CAR-T-Zellen. Hier lassen sich derzeit keine validen Aussagen zu geschlechtersensiblen Wirkung machen.
Und wie sieht es bei den Nebenwirkungen aus?
Prof. Letsch: In der Pharmakologie gibt es wichtige Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die zum Beispiel die Verstoffwechselung und Elimination von Wirkstoffen betreffen, aber auch die Verteilung im Körper. Das führt dazu, dass Männer beispielsweise einige Chemotherapeutika schneller eliminieren als Frauen, was die niedrigere Nebenwirkungsrate von Männern erklären könnte.
Wichtig erscheint mir auch, dass Frauen tendenziell häufiger Hämatotoxizitäten entwickeln als Männer sowie vermehrt Übelkeit und Erbrechen. Diese Faktoren beeinflussen die Therapiedichte und können eventuell zur Therapieunterbrechung oder zum -abbruch führen – und damit die Effektivität erheblich beeinträchtigen.
Was ist von den vielen geschilderten Unterschieden zum jetzigen Zeitpunkt handlungsrelevant?
Prof. Letsch: Es gibt in der Onkologie bisher eine einzige geschlechterunterschiedliche Dosierung – und die betrifft den CD20-Antikörper Rituximab, der in der Lymphomtherapie eingesetzt wird. Männer benötigen mit 500 mg/qm2 Körperoberfläche eine höhere Dosierung als Frauen mit 375. Bei den meisten anderen Therapeutika ist die initiale Dosiserungsempfehlung bislang noch gleich.
In diesem Bereich sehe ich viel Potenzial, die alten Daten unter den neuen Aspekten auszuwerten oder neue Daten zu erheben: Wo können wir Frauen vor einer erhöhten Toxizität schützen? Und umgekehrt, wo müssen wir die Dosierung bei Männern möglicherweise steigern, um die Therapieeffizienz auf das Niveau der Frauen zu heben?
Was kann oder sollte strukturell geändert werden?
Prof. Letsch: Wir sollten bei allen klinischen Studien ein Geschlechts- und Gender-Datenset mitlaufen lassen. Wenn wir das systematisch machen würden, hätten wir in einigen Jahren deutlich validere Daten. Diese würden eine gute Grundlage für Empfehlungen bilden, die tatsächlich therapieverändernd wären.
Was ist Ihre derzeitige Empfehlung, wenn Sie an Geschlechterunterschiede in der Onkologie denken?
Prof. Letsch: In erster Linie v.a. das Bewusstsein für Geschlechterunterschiede zu schärfen, motivieren, genauer hinzuschauen und die verfügbaren Daten öffentlich zugänglich zu machen sowie in Leitlinien und Empfehlungen zu integrieren.
Medical-Tribune-Interview