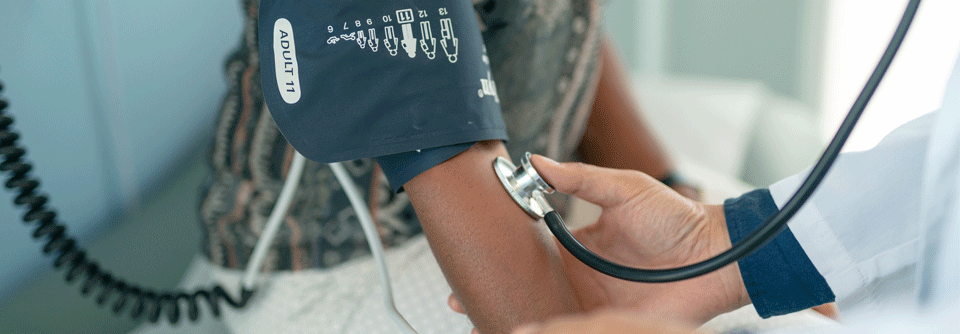Therapiemanagement Kniffelige portopulmonale Hypertonie
 Die portopulmonale Hypertonie (POPH) wird ähnliche der pulmonalen Hypertonie behandelt.
© sdecoret – stock.adobe.com
Die portopulmonale Hypertonie (POPH) wird ähnliche der pulmonalen Hypertonie behandelt.
© sdecoret – stock.adobe.com
Treffen eine portale und eine präkapilläre pulmonale Hypertonie zusammen, hat man es mit einer portopulmonale Hypertonie (POPH) zu tun. 5−15 % aller pulmonalen arteriellen Hypertonien entsprechen einer POPH – mit deutlich schlechterer Prognose, schreibt Dr. Hilary DuBrock von der Mayo Clinic in Rochester. Die genaue Pathophysiologie der portopulmonalen Hypertonie (POPH) ist unbekannt. Wahrscheinlich sind mehrere Faktoren ursächlich beteiligt – darunter Östrogen, BMP* 9 und 10, vaskulär wirksame Substanzen, ein proinflammatorisches Zytokin sowie Endothelin. Insgesamt entwickeln 5−6 % Patienten mit schwerer Lebererkrankung eine POPH. Eine höheres Risiko besteht für Frauen und bei Autoimmunhepatitis. Eine Hepatitis C hingegen senkt das Risiko.
Diagnostisch wegweisend sind Belastungsdyspnoe sowie rasche körperliche Erschöpfung. Außerdem muss zwingend neben einer portalen auch eine pulmonale Hypertonie ohne Nachweis einer anderweitigen Ursache (z.B. pulmonale Embolie, idiopathische Lungenkrankheit) vorliegen. Im Rechtsherzkatheter lässt sich die präkapilläre pulmonale Hypertonie feststellen. Hämodynamisch gelten die gleichen Kriterien wie bei anderen Formen pulmonaler Hypertonie: mittlerer pulmonal-arterieller Druck (mPAP) von > 20 mmHg, Lungengefäßwiderstand (PVR) > 2 WU und ein Wegde-Druck (PAWP) ≤ 15 mmHg. Allerdings ist auch ein PVR von 2 WU mit einer POPH vereinbar. Zu beachten ist, dass die POPH sowohl mit als auch ohne Leberzirrhose auftreten kann. Zudem korreliert der Schweregrad der POPH nicht mit dem Ausmaß der Lebererkrankung oder der Ausprägung der portalen Hypertonie.
Das therapeutische Vorgehen ähnelt dem bei anderen pulmonalen Hypertonien, auch wenn es für die POPH keine explizit zugelassenen Wirkstoffe gibt. Infrage kommen Phosphodiesterase-Hemmer, Endothelinrezeptor-Antagonisten und Prostazyklin-Analoga. Die medikamentöse Therapie verbessert meist die körperliche Leistungsfähigkeit und die hämodynamischen Parameter deutlich. Allerdings besteht bei einzelnen Wirkstoffen ein potenzielles hepatotoxisches Risiko, das zu beachten ist. Außerdem gilt: Bei POPH sind Kalziumkanalblocker zu meiden und Betablocker kontraindiziert. Auch ein transjugulärer intrahepatischer portosystemischer Shunt kann sich negativ auswirken. Hinsichtlich des Therapiemanagements sollte man mögliche Auswirkungen der Leberbeteiligung berücksichtigen. So kann eine hepatische Enzephalopathie beispielsweise die Adhärenz einschränken und komplexe Therapieschemata unmöglich machen.
Einen besonderen therapeutischen Stellenwert nimmt bei POPH die Lebertransplantation ein. Für die Indikationsstellung ist es entscheidend, die Sicherheit des Eingriffs einzuschätzen. Patienten mit schwerer POPH kommen aufgrund des erhöhten perioperativen Risikos primär nicht infrage. Eine wirksame medikamentöse Therapie jedoch kann mittelfristig zu hämodynamischen Verbesserungen führen, sodass eine Transplantation unter Umständen doch noch zu erwägen ist. Diesbezüglich wurde ein mPAP ≥ 35 mmHg bis vor einiger Zeit als Ausschlusskriterium gesehen. Dieser Grenzwert liegt nun bei > 45−50 mmHg. Inzwischen gilt eine Transplantation auch bei einem mPAP von 35−40 mmHg in Kombination mit einem pulmonalen Gefäßwiderstand von < 3 WU und erhaltener Rechtsherzfunktion als sicher. Ein mPAP von < 35 mmHg gilt in jedem Fall als sicher. Erreicht ein Patient mit POPH derartige Werte, ist eine höhere Priorisierung auf der Warteliste möglich.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass grundsätzlich wichtig ist, die Diagnose POPH überhaupt zu stellen. Daher sollte bei allen Transplantationskandidaten eine entsprechende Abklärung der Rechtsherzfunktion per transthorakaler Echokardiografie erfolgen. Ein erhöhter rechtsventrikulärer Druck oder eine Dilatation des rechten Ventrikels sprechen für eine POPH. Ein Rechtsherzkatheter kann weitere diagnostische Klarheit bringen.
Die Lebertransplantation sollte von einem mit dem Krankheitsbild vertrauten Anästhesisten begleitet werden. Unter anderem gilt es, während der Operation eine Rechtsherzbelastung zu vermeiden. Postoperativ sollte die ursprüngliche Medikation nicht abrupt abgesetzt werden, da sich die POPH während der ersten sechs Monate in einigen Fällen paradoxerweise verschlechtern kann. Etwa die Hälfte der Patienten profitiert von einer Lebertransplantation, bei einigen heilt die pulmonale Hypertonie aus. In ausgewählten Subgruppen steigt Studien zufolge die Überlebensrate. Insgesamt kann die Transplantation aber nicht als kurative Therapie betrachtet werden, schreibt Dr. DuBrock. Welche Bedeutung der Eingriff insbesondere bei POPH-Patienten mit leicht ausgeprägter Lebererkrankung haben kann, ist in zukünftigen Studien genauer zu klären.
* bone morphogenetic protein
Quelle: DuBrock HM. Chest 2023; DOI: 10.1016/j.chest.2023.01.009