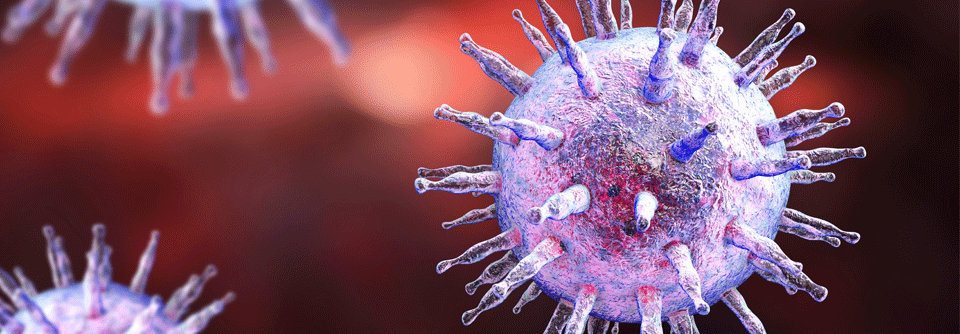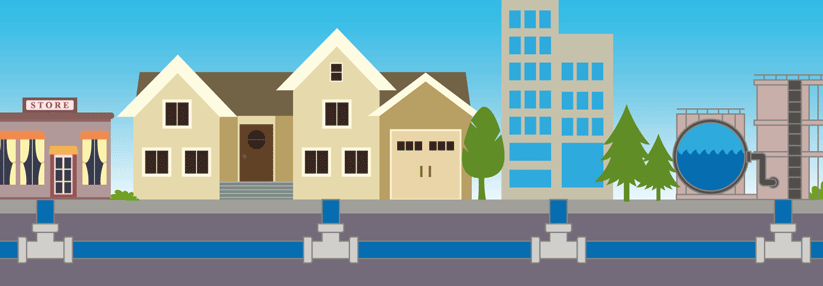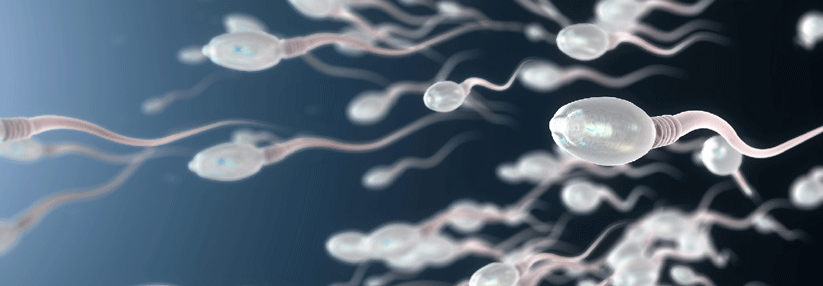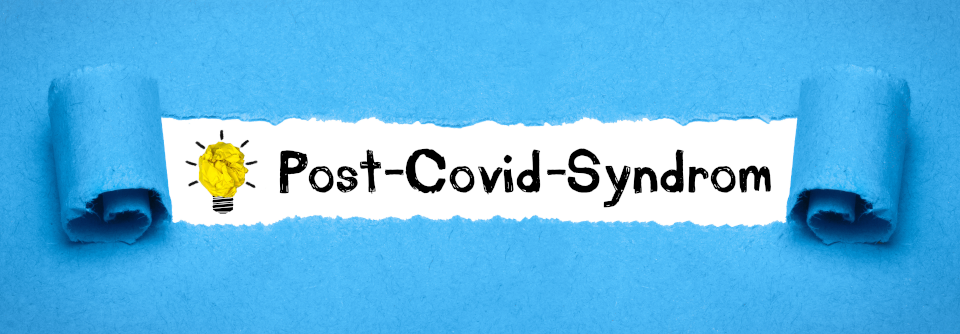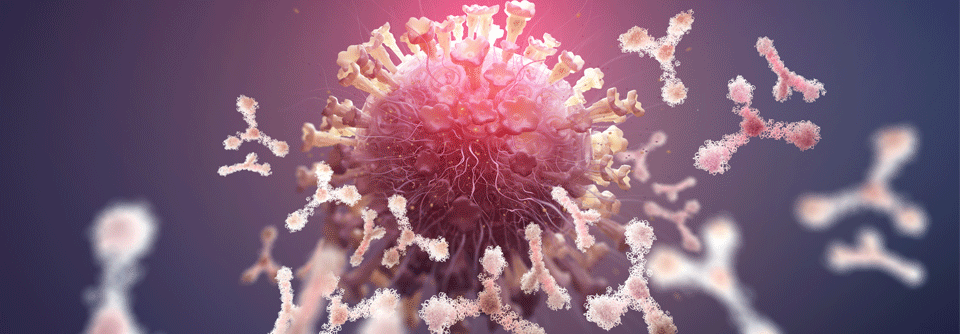Long-COVID Neue Empfehlung zur COVID-Nachsorge
 Vor allem für klinisch weitgehend stabile Long-COVID-Betroffene mit Belastungsdyspnoe seien Telemedizin und -reha sinnvoll.
© Rick – stock.adobe.com
Vor allem für klinisch weitgehend stabile Long-COVID-Betroffene mit Belastungsdyspnoe seien Telemedizin und -reha sinnvoll.
© Rick – stock.adobe.com
Auf Medizin und Gesellschaft rollt eine Welle von Patienten mit prolongiertem COVID-Verlauf zu, die man allenfalls durch ein strukturiertes Herangehen bewältigen kann. Ob ein Patient Long-COVID entwickeln wird, lässt sich im Einzelfall kaum vorhersagen. Als Risikofaktoren gelten Alter, weibliches Geschlecht und vor allem die Zahl der Symptome in der ersten Woche der Infektion. Keine Aussagekraft haben in diesem Zusammenhang initialer Schweregrad, Bildgebungsbefunde oder Lungenfunktion. Allerdings nehmen sie Einfluss darauf, wie gravierend die Langzeitsymptome ausfallen. Deren Intensität variiert ebenso stark wie die Organbeteiligung, was Erfassung und Management von Long-COVID enorm verkompliziert.
Nachsorge orientiert sich an betroffenen Organen
Ein Expertengremium der ERS hat via Medline und Cochrane Central Register of Control Trials bis Ende März 2021 erschienene Publikationen identifiziert, ausgewertet und anhand der Ergbnisse eine nach Organsystemen gegliederte Strategie für die Nachsorge stationär behandelter COVID-19-Patienten entwickelt. Die meisten der einbezogenen Arbeiten beschäftigten sich mit dem Zeitraum zwischen einem und sechs Monaten nach Entlassung, sodass die Empfehlungen sich darauf beschränken, erklärte einer der Konsensusautoren, Prof. Dr. Antonio Spanevello von der Universität Padua.
Ein Manko aus seiner Sicht: Die Expertengruppe konnte sich nicht darauf einigen, für die von ihr empfohlenen Untersuchungen bestimmte Intervalle vorzuschlagen. Diese Entscheidung bleibt also jedem niedergelassenen Kollegen und jedem Zentrum selbst überlassen. Die Empfehlungen des Gremiums:
Eine generelle systematische PCR-Kontrolle des Infektionsverlaufs halten die Experten nicht für sinnvoll, da die wissenschaftliche Evidenz hierzu fehlt. Sie plädieren dafür, die Entscheidung für und gegen die Messung individuell zu fällen. Sinnvoll erscheint ihnen die sequenzielle Testung vor allem bei Patienten, die aufgrund einer Immundefizienz besonders gefährdet erscheinen.
Thromboembolische Komplikationen prägen oft das Initialbild von COVID-19, können aber auch nach virologischer Ausheilung auftreten. Eine Bildgebung sollte Patienten mit schwerem Verlauf oder poststationär neu aufgetretenen bzw. progredienten Symptomen vorbehalten bleiben.
Aus pneumologischer Sicht sind vor allem Lungenembolien und mikrovaskuläre Verschlüsse in der Lungenstrombahn relevant, die durch hochauflösende Kontrastmittel-CT, Messung der Diffusionskapazität (DLCO) und – sofern verfügbar – Prüfung der Lungenperfusion per SPECT oder DECT ausgeschlossen werden sollten. Bei Patienten mit Belastungsdyspnoe, aber normaler Spirometrie und unauffälliger CT empfiehlt sich die Echokardiografie zum Ausschluss kardialer Funktionsstörungen.
Natürlich gehört die Lungenfunktion auf den Prüfstand mit Spirometrie und DLCO (korrigiert für den Hb-Wert) – und nicht nur bei symptomatischen Patienten. So lässt sich eine Verschlechterung erkennen, auch wenn sie sich noch nicht in Dyspnoe und Belastungsintoleranz äußert. Eine reduzierte DLCO findet sich bei bis zu zwei Drittel der Patienten und kann auch bei normalisiertem CT-Befund Monate überdauern.
Sowohl kognitive als auch psychosomatische und psychische Folgeerscheinungen der Erkrankung wie Angst, Depression und Schlafstörungen belasten viele COVID-19-Patienten noch lange. Wichtig ist, die Betroffenen, aber auch ihre Angehörigen und Pflegenden regelmäßig danach zu fragen. Die Patienten früh in ein Rehabilitationsprogramm einzuschließen, kann die Folgeerscheinungen mildern und der Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung entgegenwirken.
Was aktuell fehlt, ist ein Konsens darüber, wie solche Symptome und die Folgen für die Lebensqualität in der Praxis ermittelt und wann welcher Patient zur Reha angemeldet werden sollte, bemängelte Prof. Spanevello.
Auf Dauer behindernd wirken sich vor allem Dyspnoe und Fatigue aus. Diesen Symptomen sollten die Ärzte deshalb besonderes Augenmerk schenken. Zum Monitoring eignen sich Messungen von Belastungstoleranz, Muskelkraft, Mobilität und Selbstständigkeit im Alltag.
Prof. Spanevello riet, die Möglichkeiten der telemedizinischen und telerehabilitativen Betreuung ergänzend zu nutzen. Das entlaste nicht nur Ärzte und Praxispersonal. Es erspare zudem den Patienten Wege. Vor allem für klinisch weitgehend stabile Long-COVID-Betroffene mit Belastungsdyspnoe seien Telemedizin und -reha sinnvoll.
Quellen:
1. European Respiratory Society International Congress
2. Antoniou KM et al. Eur Respir J 2022; DOI: 10.1183/13993003.02174-2021