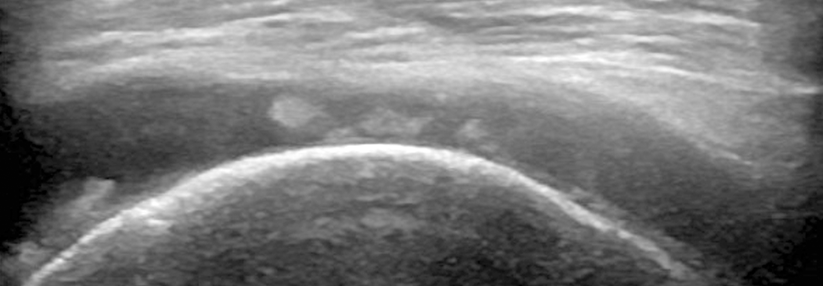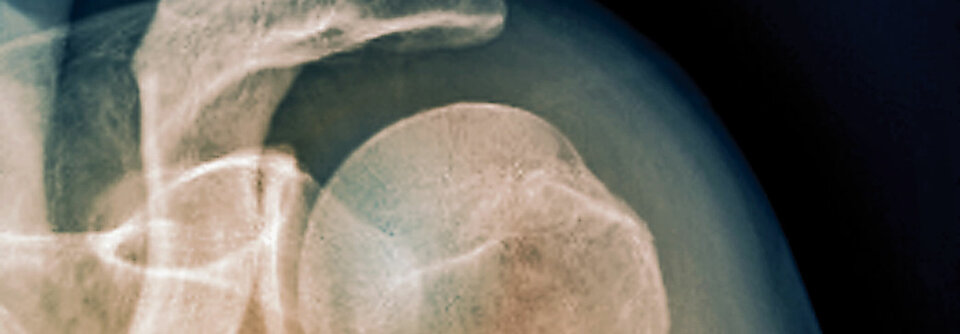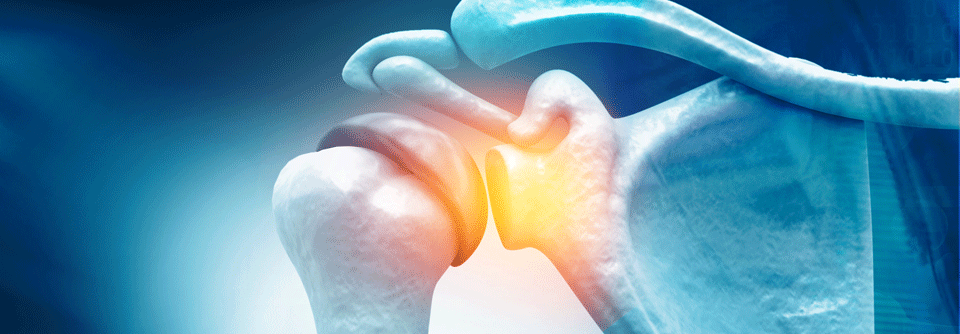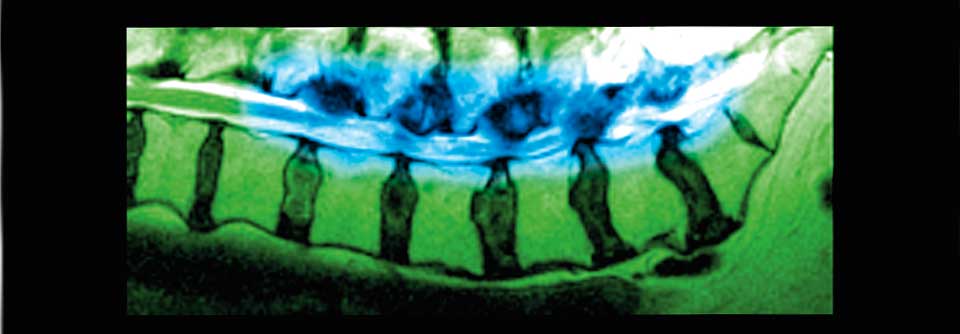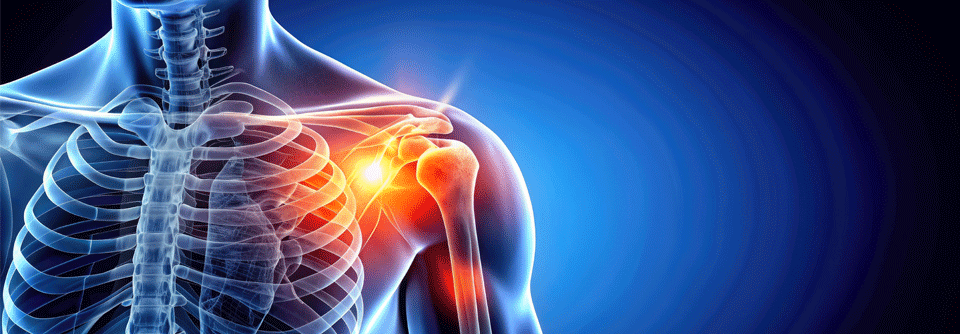Schulterschmerzen: OP birgt mehr Risiken als Physiotherapie
 Bei hartnäckigen Schulterschmerzen besser zur Physiotherapie gehen.
© iStock.com/sefa ozel
Bei hartnäckigen Schulterschmerzen besser zur Physiotherapie gehen.
© iStock.com/sefa ozel
Annähernd jeder vierte Erwachsene litt im letzten Jahr an Schulterschmerzen. Bei bis zu 70 % waren sie unterhalb des Akromions lokalisiert. Obwohl die Hälfte der Patienten innerhalb eines halben Jahres wieder beschwerdefrei ist, können länger als drei Monate anhaltende Schmerzen das Risiko schlechterer Outcomes erhöhen. Zur Behandlung werden in erster Linie Analgetika (z.B. Paracetamol, NSAR), Glukokortikoidinjektionen und Physiotherapie verordnet.
Infektionen, Thromboembolien und Nervenverletzungen
Die subakromiale Dekompressionsoperation, bei der man die Bursa subacromialis sowie Knochensubstanz von der Unterseite des Akromions entfernt, dient als Zweitlinientherapie bei länger anhaltenden Beschwerden. Die Anzahl der arthroskopischen Eingriffe nimmt zu, in britischen Krankenhäusern lag die Zahl 2010 bei etwa 21 000. Ihr Nutzen ist dagegen umstritten, bisherige internationale Leitlinien widersprechen sich in ihren Empfehlungen.
Veränderte Bursa auch bei symptomfreien Personen
Gut informierte Patienten würden die OP ablehnen
Die Experten zeigten sich überzeugt, dass sich „fast jeder gut informierte Patient“ aufgrund des Kosten-Nutzen-Verhältnisses gegen eine Operation entscheiden würde. In einer „rapid recommendation“ sprechen sie daher eine starke Empfehlung gegen die subakromiale Dekompressionsoperation aus. Außerdem solle bei subakromialen Schulterschmerzen die operative Therapie nicht unaufgefordert angeboten und Patienten über die Risiken aufgeklärt werden. Aussagen über potenziell effektive Behandlungsalternativen waren aufgrund des Studiendesigns nicht möglich.Quelle: Vandvik PO et al. BMJ 2019; 364: l294