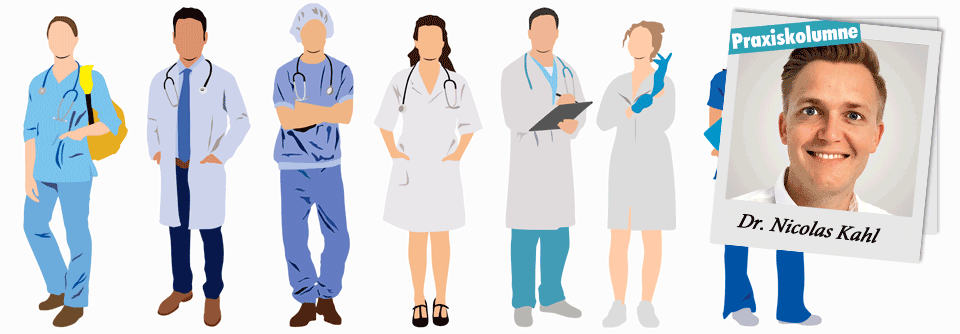Praxiskolumne Chronisch kranke Kinder im Schatten der Pandemie
 Die betroffene Mutter klagt: „Die nehmen in Kauf, dass mein Sohn ein Kollateralschaden sein kann.“ (Agenturfoto)
© Victor – stock.adobe.com; MT
Die betroffene Mutter klagt: „Die nehmen in Kauf, dass mein Sohn ein Kollateralschaden sein kann.“ (Agenturfoto)
© Victor – stock.adobe.com; MT
„Es ist, wie wenn ich das Leben draußen durch eine Milchglasscheibe beobachte.“ Die Pandemie und das Verhalten der Gesellschaft in der Pandemie hat viele zurückgelassen. In Deutschland sind etwa 91.500 Menschen inzwischen an einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben. Andere leiden unter Nachwirkungen wie Long-COVID. Doch auch die Kollateralschäden sind immens. Viele sind sozial vereinsamt, weitere finanziell ruiniert.
Für mich steht der Schutz von Gesundheit und Leben an erster Stelle, weshalb ich hinter nicht-medizinischen Maßnahmen voll stehe. Doch ich sehe auch das Leid, das eine solidarischere Art und Weise, mit der Situation umzugehen, hätte verhindern können.
Für mich persönlich wäre die solidarischste Variante eine No-COVID-Strategie gewesen mit frühzeitigen, harten und dadurch kürzeren Maßnahmen sowie viel Testen, um nicht in diese Dauerschleife des Lockdowns, der Verdrossenheit und des daraus resultierenden wirtschaftlichen Schadens zu gelangen. Und um nicht so viele Menschen auf sich allein gestellt zurückzulassen. Doch das haben wir getan.
Ich denke da an die Mutter eines chronisch kranken Jungen im Alter von neun Jahren, die mir gegenüber den eingangs geschriebenen Satz äußerte. Geboren mit einer Transposition der großen Arterien, in frühester Kindheit operiert, mit Bradykardiesyndrom und später diagnostiziertem Immundefekt. Schlicht ein Kämpfer.
Aber auch der Grund für die Mutter, seit seiner Geburt zu kämpfen. Für ihn und seine Chancen, letztlich um sein Leben. Sie hat den Begriff „Schattenfamilien“ dafür gefunden, denn das ist, wie es sich für sie und so viele andere Familien mit vulnerablen Kindern anfühlt.
Im Laufe der Pandemie hat sich ihr Kampf verschärft. Die Mutter schottete sich und die Kinder ab soweit möglich, kämpfte gegen die Präsenzpflicht des Jungens und seiner großen Schwester, die ihn durch Infektion gefährden könnte. Sie schaffte es sogar, dass der Kultusminister ihres Bundeslandes mit ihr in einem Videocall über die Problematik und den Schutz ihres Sohnes sprach. Und dabei wurde ihr bewusst: „Die haben die Schattenfamilien und die gefährdeten Kinder gar nicht auf dem Schirm.“ Das gab der Minister ihr gegenüber auch offen zu. Die Präsenzpflicht für die Kinder war damit zunächst vom Tisch.
Im weiteren Verlauf jedoch wurde es wieder schwieriger und der Druck stieg, dass die Kinder in die Schule müssten. Trotz guter Noten beim Homeschooling. „Die nehmen in Kauf, dass mein Sohn ein Kollateralschaden sein kann.“ Beim letzten Termin in der betreuenden Kardiologie hatte eine Kollegin, die den Jungen und seine Vorgeschichte nicht kannte, allein anhand des pathologischen EKGs gedacht, er sei „eines der COVID-Herz-Kinder“. Es gäbe dort viele Kinder mit solchen Bradykardien. Diese Information war natürlich für eine Mutter mit so einem vorerkrankten Kind sehr beunruhigend zu hören.
Dass nun zunehmend die Masken- oder Testpflicht entfällt, bei fehlender Impfzulassung unter zwölf Jahren, war für meine Patientin kaum noch zu verstehen. „Wir sind doch nicht die einzigen, die sich noch nicht schützen konnten und Risikopatienten sind!“ Der Rückzug in die Isolation ist also wieder angesagt.
Steigende Inzidenzen, anfänglich beinahe schon das Abraten eines STIKO-Vorsitzenden von der Impfung von Kindern über zwölf Jahren, das Propagieren der Abschaffung von Tests in Schulen mit zeitgleichen Forderungen nach Präsenzpflicht, steigende Infektiosität durch die Delta-Variante – die Zeichen stehen auf Durchseuchung. NRW-Familienminister Dr. Joachim Stamp propagiert: „Alle sind für sich selbst verantwortlich!“ Sozialdarwinismus scheint angesagt.
Der Zweifel an der Benignität einer Coronainfektion sollte insgesamt etwas mehr Gehör bekommen, denn die wirklichen Spätfolgen sind uns nicht bekannt. Was uns aber bekannt ist, ist dass es Kinder wie den geschilderten Neunjährigen gibt. Nicht vereinzelt, sondern zuhauf. Und die lassen wir gerade im Stich.