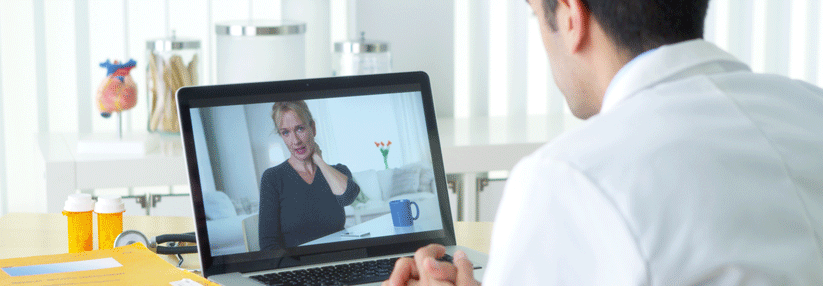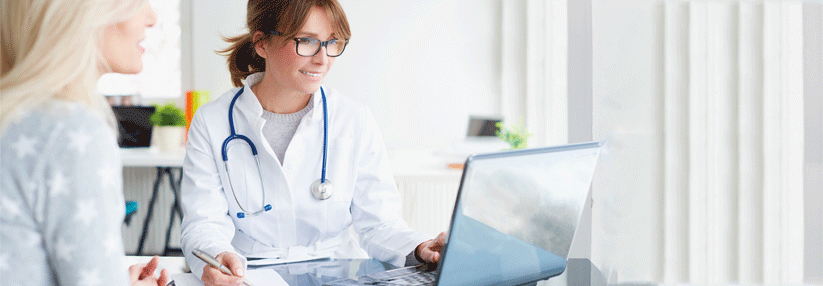Gemeinsame Notfallversorgung, gleiche Honorare?
 Wie Grenzen zwischen ambulanter und stationärer medizinischer Versorgung überwunden werden könnten.
© fotolia/zenstock
Wie Grenzen zwischen ambulanter und stationärer medizinischer Versorgung überwunden werden könnten.
© fotolia/zenstock
Die Zusammenarbeit zwischen den Sektoren im Gesundheitswesen funktioniert immer noch nicht, beklagt Barbara Steffens (Grüne). Die Hauptursache sieht die Gesundheitsministerin von NRW in Finanzierungshemmnissen. Deren Beseitigung sei die "entscheidende Herausforderung auf Bundesebene" nach der Bundestagswahl.
Auch dem Bundesgesundheitsministerium liegt viel an einer "Überwindung der Schnittstellen", sagte Oliver Schenk, BMG-Abteilungsleiter Grundsatzfragen, beim "Gesundheitskongress des Westens". Der demografische Wandel stelle im Gesundheitswesen "eine Herkulesaufgabe" dar, die nicht in zwei Legislaturperioden zu lösen sei. Schenk hofft auf ein "Umdenken" der Akteure: weg von "viel hilft viel", hin zu sektorübergreifender Kooperation.
Vergütungssystem muss Besonderheiten abbilden
Honorarpolitik sei stets auch Strukturpolitik, betonte Dr. Wolfgang-Axel Dryden, Vorsitzender der KV Westfalen-Lippe. Eine Gebührenordnung habe z.B. abzubilden, dass Hausärzte einen geringeren technischen Aufwand betreiben als Spezialisten, dafür aber zuwendungsintensiver arbeiten. Das müsste etwa bei der Bemessung eines Bereitstellungszuschlags beachtet werden. Hinzu kommen regionale Einflüsse: In einer Ruhrgebietspraxis herrsche sicherlich eine "höhere Kontaktfrequenz" während der Sprechstunde als in Mecklenburg-Vorpommern. Dafür gebe es im Norden einen höheren Hausbesuchsaufwand infolge der geringeren Siedlungsdichte.
Die Vergütungen der Leistungen in Krankenhaus und Praxis beinhalteten ebenfalls Strukturelemente und damit große Unterschiede, erklärte der KV-Chef: Kliniken bekommen die Investitionen aus Landesmitteln finanziert, der Vertragsarzt muss die Praxisausstattung selbst bezahlen. Die Arztpraxis hat "Facharztstatus" zu bieten, die Klinik nur "Facharztstandard". Dr. Dryden: "Man sollte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen."
Erlaubnis- gegen Verbotsvorbehalt
Die Unterscheide gehen noch weiter, ergänzte Dr. Bernhard Rochell, Verwaltungsdirektor der KBV. Beispiel Belegarztwesen: Heute unterliege ein Belegarzt bei seinen stationären Leistungen dem EBM, innovative Leistungen könne er nur erbringen, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss sie erlaubt hat (Erlaubnisvorbehalt). Die Hauptabteilung eines Krankenhauses dagegen dürfe innovative Leistungen erbringen, sofern sie nicht verboten sind (Verbotsvorbehalt). Eine Vereinheitlichung hält Dr. Rochell hier für dringend geboten und kurzfristig machbar. Genauso könne die Notfallversorgung einheitlich organisiert und finanziert werden, meint Dr. Rochell. "Am besten extrabudgetär."
Die GOÄ allerdings sollte von Harmonisierungsbestrebungen verschont bleiben, riet der Vergütungsexperte, schon wegen des "Systemwettbewerbs um Innovationen" im dualen System von privater und gesetzlicher Krankenversicherung.
Jochen Brink, Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, betonte die "unterschiedlichen Systemphilosophien" von DRG und EBM bzw. GOÄ. Zu beachten sei, dass die Klinikfallpauschalen Vorhalte- und Overheadkosten enthielten und auch Fallmix und Risikoverteilung in Krankenhaus und Praxis unterschiedlich sind.
Notfallprobleme mit einem Big Bang lösen
Die Notfallversorgung sektorenübergreifend zu organisieren, hält auch Brink für machbar. In Nordrhein-Westfalen werde versucht, unter Beteiligung aller Akteure eine Lösung aus einem Guss zu finden.
An eine Reform auf einen Streich glauben aber weder Brink noch Dr. Rochell. Das würde schon an der unterschiedlichen Planung von ambulantem und stationärem Bereich scheitern. "Wir müssen das Ganze von unten her aufbauen", waren sich Klinik- und Praxisvertreter einig.
Das geht dem Sachverständigenrat fürs Gesundheitswesen zu langsam. Er tendiere eher zum "Big Bang", sagte Ratsmitglied Professor Dr. Wolfgang Greiner. In seinem nächsten Gutachten werde sich das Gremium für eine große Lösung aussprechen.
Quelle: Gesundheitskongress des Westens