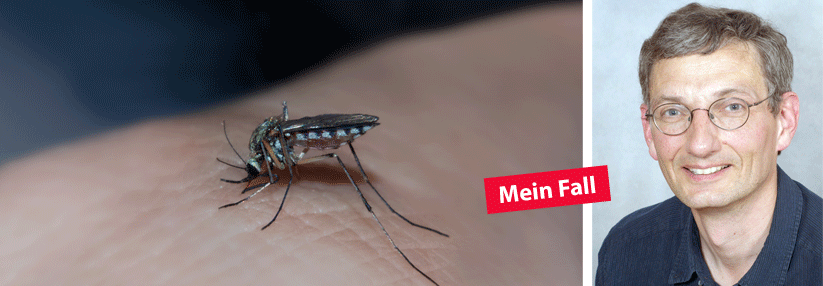Angriffe von Insekten und Milben richtig einordnen
 Von links nach rechts: Bienenstich, Raupendermatitis durch Eichenprozessionsspinner und Bettwanzenbisse.
© Science Photo Library/Matulavich, Peter; wikimedia/Daniel Ullrich, Oliver Arend
Von links nach rechts: Bienenstich, Raupendermatitis durch Eichenprozessionsspinner und Bettwanzenbisse.
© Science Photo Library/Matulavich, Peter; wikimedia/Daniel Ullrich, Oliver Arend
Ein Stich bzw. Biss von einem Insekt oder einer Zecke ist nicht immer harmlos. Das diagnostische Vorgehen richtet sich nach dem Risiko, dem der Patient ausgesetzt ist. An erster Stelle steht der Ausschluss anaphylaktischer Symptome wie Tachykardie, Dyspnoe, Blutdruckabfall und anderer schwerer allergischer Reaktionen. Sie erfordern möglicherweise eine notfallmäßige stationäre oder fachärztliche Therapie. Um solche besonders gefährdeten Patienten zu erkennen, hilft die Frage nach bereits erlebten Anaphylaxien oder Angioödemen.
Sind Familienmitglieder ebenfalls betroffen?
Vorsichtshalber sollte man die Körpertemperatur, Blutdruck und Puls in den Blick nehmen sowie nach Zeichen einer Lymphangitis schauen. Vor allem bei Risikopatienten kann sich eine Superinfektion rasch ausbreiten, was bis zur Sepsis reichen kann, warnen Dr. Jane Wilcock, Hausärztin im britischen Salford, und Kollegen. Auch nach Auslandsreisen in der jüngeren Vergangenheit sollte man fragen, insbesondere nach Aufenthalten in den Tropen und Subtropen. Mit einem harmlos erscheinenden Stich könnte sich der Patient dort eine lebensbedrohliche Erkrankung wie Malaria, Dengue- oder Gelbfieber eingefangen haben.
Wichtige Hinweise auf den möglichen Urheber liefern Angaben zu Outdooraktivitäten, Tierkontakten und gleichfalls betroffenen Familienmitgliedern. Wichtig ist es, genau hinzusehen, mahnen die Autoren. Denn Dermatosen wie Varizellen, Gürtelrose, Impetigo, ein bullöses Pemphigoid und die Pyoderma gangraenosum können vor allem zu Beginn Insektenbissen oder -stichen täuschend ähnlich sehen. Verwechslungsgefahr besteht auch mit Effloreszenzen, die durch Raupen wie dem Eichenprozessionsspinner oder bestimmte Pflanzen, etwa dem Riesenbärenklau oder dem Giftsumach, ausgelöst werden. Wichtig ist auch die Differenzierung von Biss und Stich, schreiben die Kollegen. Zu den Bissen zählen sie sämtliche durch Mundwerkzeuge erzeugte Wunden, also auch die Läsionen durch Mücken oder Wanzen. Für den Stich wird nach ihrer Einteilung ein Stachel benötigt, wie ihn die Hymenopteren (Bienen und Wespen) tragen.
Ärmel statt Knoblauch
Entzündungszeichen bedeuten noch keine Superinfektion
Blutsaugende Insekten und Spinnentiere geben Speichel in die Bisswunde, um die Gerinnung auszuschalten. Auf die darin enthaltenen Antikoagulanzien, Vasodilatatoren und Verdauungsenzyme reagieren die Opfer sehr unterschiedlich. Kurz nach der Attacke bildet sich oft eine Quaddel auf erythematösem Grund. Als spätere Reaktionen folgen Pruritus, indurierte Papeln, Urtikaria und Blasen, teils mit ausgedehnter Hautrötung. Schwere systemische Reaktionen sind nach Insektenbissen selten und eher typisch für Wespen- und Bienenstiche. Wichtig für die Praxis: Erythem, Schwellung, Überwärmung, Schmerz und Juckreiz sind keine Zeichen für eine Superinfektion. Diesbezüglich können Sie die Betroffenen beruhigen. Die Reaktionen erreichen meist nach zwei bis drei Tagen ihr Maximum und bilden sich innerhalb von 10–14 Tagen zurück. Wenn Sie den Rand des Erythems mit einem Stift markieren, kann der Patient bei der Heilung zusehen. Kalte Umschläge, orale Antihistaminika und die kurzzeitige Anwendung topischer Steroide reduzieren den Juckreiz und mindern das Risiko für eine Superinfektion. Bakterienverdächtig ist eine Ausbreitung des Erythems, statt des erwarteten Rückgangs. Allerdings lässt sich eine beginnende Cellulitis oft nur schwer von der normalen Stich- oder Bissreaktion unterscheiden. Als Zeichen einer fortschreitenden Infektion kann es zu einer purulenten Sekretion und fluktuierenden Schwellung kommen. Systemische Reaktionen sind ebenfalls möglich. Selten, aber gefährlich ist die nekrotisierende Fasziitis. Sie macht sich mit starken Schmerzen bemerkbar, die nicht zu den vergleichsweise leichten Hauterscheinungen passen. Zusätzlich kann es zu Fieber, Lymphangitis und einer starken Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens kommen. Zu den Risikofaktoren für eine Superinfektion zählen Immunsuppression, Diabetes und hohes Alter. Auch Lymphödeme, venöse Stauung, Beinischämie und periorbitale Manifestation begünstigen die bakterielle Invasion. Als Antibiotikum der ersten Wahl empfehlen die Autoren Flucloxacillin.Quelle: Wilcock J et al. BMJ 2020; 370: m2856; DOI: 10.1136/bmj.m2856
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).