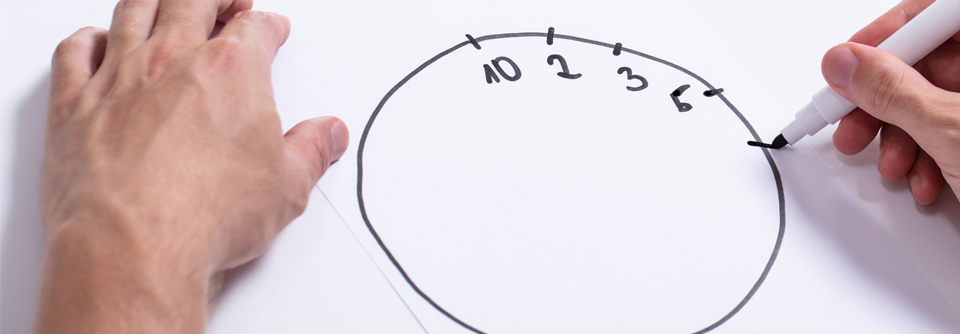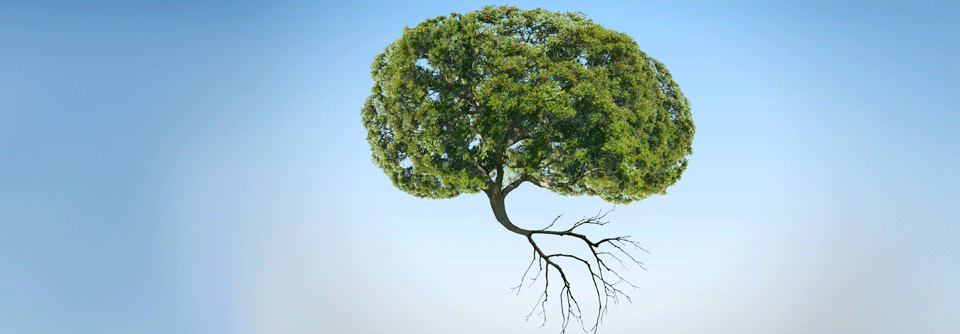Demenz: Allgemeinmaßnahmen sorgen für einen besseren Schlaf
 Feste Zeiten fürs Zubettgehen und Aufstehen sowie Aufenthalte im Freien können Demenzpatienten zu besserem Schlaf verhelfen. (Agenturfoto)
© Ocskay Mark – stock.adobe.com
Feste Zeiten fürs Zubettgehen und Aufstehen sowie Aufenthalte im Freien können Demenzpatienten zu besserem Schlaf verhelfen. (Agenturfoto)
© Ocskay Mark – stock.adobe.com
An erster Stelle steht bei Demenzpatienten mit gestörtem Schlaf die optimale Therapie der oft zahlreichen Begleiterkrankungen. Dazu gehört die Überprüfung der Medikation auf schlafstörende Effekte, schreiben Professor Dr. Helmut Frohnhofen von der Universität Witten-Herdecke und Kollegen.
Immer den Wecker stellen und vormittags an die frische Luft
Der häufig beeinträchtigte Tag-Nacht-Rhythmus lässt sich in der Regel durch einfache Verhaltensänderungen stabilisieren. Empfohlen werden feste Zeiten fürs Zubettgehen und Aufstehen sowie ein vormittäglicher Aufenthalt im Freien. Tagsüber sollten die Patienten nicht länger im Bett liegen und höchstens 30 Minuten Mittagsschlaf halten. Stimulierende Getränke wie Kaffee, Tee oder Kakao sowie große Mahlzeiten sind abends tabu.
Mobile Patienten mit leichter Demenz können von einer Stimuluskontrolle profitieren. Falls sie nicht einschlafen können, sollten sie aufstehen und sich einer entspannenden Tätigkeit widmen. Das kann mehrmals in der Nacht wiederholt werden. Wichtig ist die feste Aufstehzeit am Morgen.
Kognitiv noch nicht stark eingeschränkte Schlafapnoe-Patienten profitieren häufig von der nächtlichen Überdruckbeatmung. Auf Alkohol und Sedativa sollten sie verzichten, weil diese die Atemaussetzer verschlimmern. Demenzkranke mit Restless-Legs-Syndrom sprechen rasch auf eine dopaminerge Behandlung an. Zuvor sollten allerdings ein Eisenmangel oder Psychopharmaka als Ursache der Störung ausgeschlossen werden.
Neuroleptika wie Melperon, Pipamperon und Risperidon können Insomnie und Unruhe wirksam lindern. Sie dürfen aber nur bei klarer medizinischer Indikation verordnet werden, denn die positiven Effekte werden mit einem erhöhten Sturzrisiko und einer gewissen Übersterblichkeit erkauft. Promethazin ist in dieser Indikation eine Off-Label-Anwendung und sollte wegen seiner anticholinergen Wirkung gemieden werden. Auch unter Benzodiazepinen und den sogenannten Z-Substanzen muss man mit einer vermehrten Fallneigung rechnen, zudem besteht erhebliches Abhängigkeitspotenzial. Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe dürfen diese Behandlung nicht erhalten.
Trazodon erzielt einen relevanten Effekt bei guter Verträglichkeit, kann aber eine orthostatische Hypotonie auslösen. Mirtazapin (15 mg) verlängert die nächtliche Schlafzeit nicht und führt häufig zu Tagesschläfrigkeit. Außerdem entwickelt etwa ein Drittel der Behandelten ein Restless-Legs-Syndrom. Allerdings eignet sich dieser stimmungsaufhellende und sedierende Wirkstoff gut zur Behandlung depressiver Episoden.
Bei Patienten, die ihre Träume motorisch ausagieren (REM-Schlaf-Verhaltensstörung), lohnt sich ein Versuch mit Melatonin. Eine nicht kausal behandelbare Hypersomnie kann eventuell mit Stimulanzien wie Methylphenidat, Modafinil oder Solriamfetol gelindert werden. Allerdings gibt es dafür in der Geriatrie bisher kaum Erfahrungen. Agitiertheit, Angst oder Delir sind keine primären Schlafstörungen und bedürfen einer spezifischen Therapie, betonen die Autoren.
Quelle: Frohnhofen H et al. Dtsch Med Wochenschr 2021; 146: 719-722; DOI: 10.1055/a-1417-1837
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).