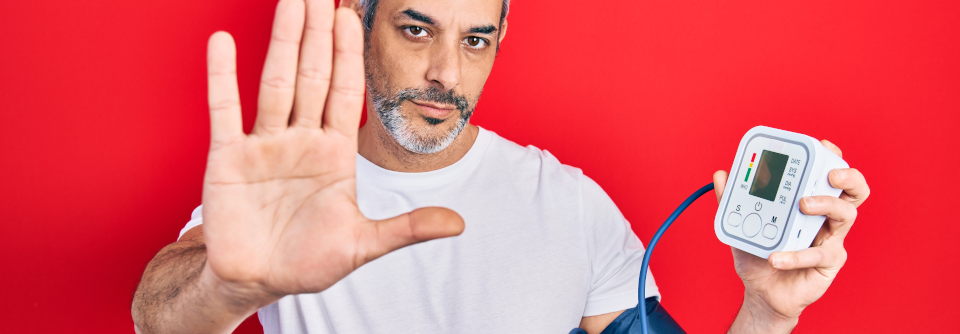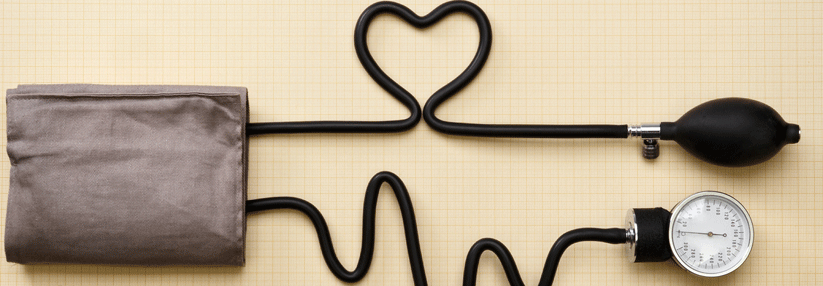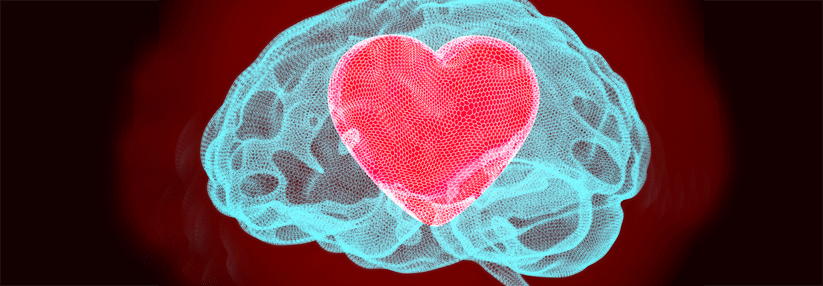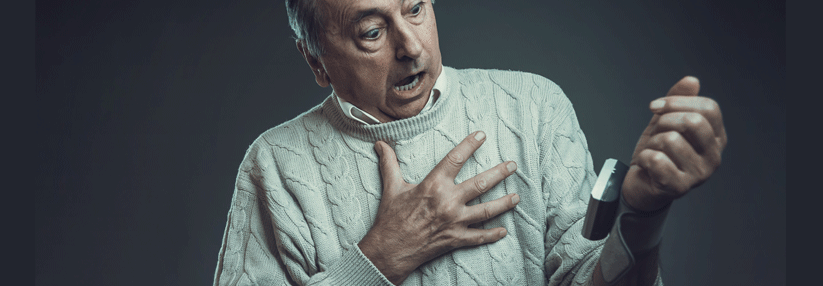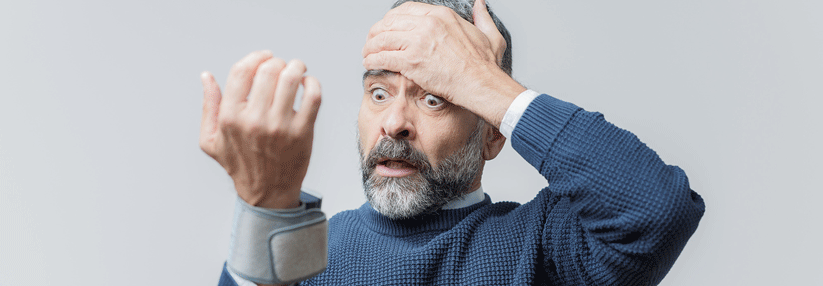
Hypertensive Entgleisung: Wenn der Blutdruck boomt
 Handelt es sich um einen hypertensiven Notfall, muss schleunigst der Blutdruck kontrolliert und anschließend langsam gesenkt werden.
© fotolia/WavebreakMediaMicro
Handelt es sich um einen hypertensiven Notfall, muss schleunigst der Blutdruck kontrolliert und anschließend langsam gesenkt werden.
© fotolia/WavebreakMediaMicro
Etwa 0,5–3 % aller medizinischen Notfälle sind Patienten mit einer akuten hypertensiven Entgleisung. Deren Inzidenz liegt bei bekanntem Bluthochdruck bei etwa 1 % pro Jahr; bei 10–25 % der Betroffenen war in der Vorgeschichte keine arterielle Hypertonie bekannt.
Ursache für den kritischen Blutdruckanstieg können neben essenziellen, endokrinen oder renalen Hypertonieformen auch Medikamente (beispielsweise Sympathomimetika, Erythropoetin, NSAR und Ciclosporin), zerebrovaskuläre Erkrankungen oder Drogen (unter anderem Kokain oder Amphetamine) sein. Eine rasche Dosissenkung von Betablockern oder zentralen Antisympathomimetika kann zu einer Rebound-Hypertonie führen.
Eine einheitliche internationale Einteilung für die Blutdruckwerte bei der hypertensiven Krise gibt es nicht. Meist treten die typischen Symptome wie Dyspnoe, thorakaler Druck und Kopfschmerzen bei RR-Werten > 180/110–120 mmHg auf. Bei langjährigen Hypertonikern kann das aber auch erst bei deutlich höheren Werten der Fall sein (> 220/120–130 mmHg), schreibt Dr. Olaf Eberhardt von der Klinik für Neurologie des Klinikums Bogenhausen in München. Schwangere hingegen können im Rahmen einer (Prä-)Eklampsie schon bei niedrigeren Blutdruckwerten symptomatisch werden.
Messung im Stehen an beiden Arme
In etwa 75 % der Fälle handelt es sich um eine hypertensive Krise ohne Endorganbeteiligung. Treten jedoch Symptome auf, die auf eine mögliche neurologische, okuläre, kardiopulmonale oder renale Organmanifestation hindeuten, handelt es sich um einen hypertensiven Notfall. Da von der Diagnose das weitere therapeutische Vorgehen abhängt, sollte die Akutdiagnostik folgende Maßnahmen beinhalten:
- Blutdruckkontrolle an beiden Armen, möglichst auch im Stehen
- kardiopulmonale und abdominelle Auskultation
- Kontrolle des peripheren Pulsstatus
- Laboruntersuchung: BB, BZ, Kreatinin, GFR, Harnstoff, Elektrolyte, TSH, BNP, Troponin, LDH, CK/CK-MB, D-Dimere, Urinstatus
- Elektrokardiographie
- Fundoskopie
- ggf. Drogenscreening
Liegt beim Patienten eine hypertensive Krise vor, kann die Therapie mittels oraler Medikamente ambulant erfolgen. Der Blutdruck sollte dabei allerdings nur langsam gesenkt werden, um einen übermäßigen Druckabfall zu vermeiden. Dies lässt sich beispielsweise mit Nifedipin-Retardtabletten (10–20 mg p.o.; cave: intrakranieller Druckanstieg!) oder Nitrendipin erreichen (5 mg s.l./10 mg p.o.). Beide Wirkstoffe können im Falle einer Hypovolämie gegeben werden.
Bei Euvolämie kommen auch Urapidil, Ramipril, Captopril oder Losartan infrage, bei Hypervolämie Furosemid. In der Regel lässt sich der Blutdruck auf diese Weise innerhalb von 48 Stunden wieder in den Griff bekommen. Eine intravenöse Therapie ist nicht erforderlich. Sie birgt zudem die Gefahr eines übermäßigen Blutdruckabfalls in 5–10 % der Fälle, was wiederum das Risiko für Schlaganfall oder Tod erhöht.
Notfälle intravenös behandeln
- ischämischer Schlaganfall: Urapidil, Esmolol, Dihydralazin
- intrazerebrale Blutung: Clevidipin, Urapidil, Esmolol
- akute Herzinsuffizienz und Lungenödem: Nitroglycerin oder Nitroprussid plus Furosemid, Clevidipin, Urapidil plus Furosemid
- Aortendissektion: Esmolol, Metoprolol, Nitroprussid plus Betablocker, Nitroglycerin plus Betablocker
- Herzinfarkt: Esmolol, Metoprolol, Nitroglycerin plus Betablocker, Clevidipin, Urapidil
- akutes Nierenversagen: Clevidipin, Nitroprussid (< 24 Stunden), Urapidil, Clonidin, Furosemid (bei erhaltener Diurese)
- (Prä-)Eklampsie: Methyldopa (nicht post partum), Urapidil, Metoprolol, Esmolol, Nitroglycerin i.v. bei Lungenödem
Beim Lungenödem muss der Druck extrem schnell sinken
Ein hypertensiver Notfall mit Organschädigung hingegen erfordert eine zügige intravenöse Therapie, um den Blutdruck schon innerhalb der ersten Stunde um 15–25 % zu senken. Nach zwei bis sechs Stunden sollten die RR-Werte dann bei etwa 160/100–110 mmHg liegen. Noch schneller muss die antihypertensive Therapie bei einem Lungenödem oder einer akuten Aortendissektion greifen. Eine solche rasche Blutdrucksenkung kann auch bei zerebralen Aneurysmen, Aortenaneurysmen oder einer chronischen Aortendissektion erwogen werden.Quelle: Eberhardt O. Fortschr Neurol Psychiatr 2018; 86: 290-300
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).