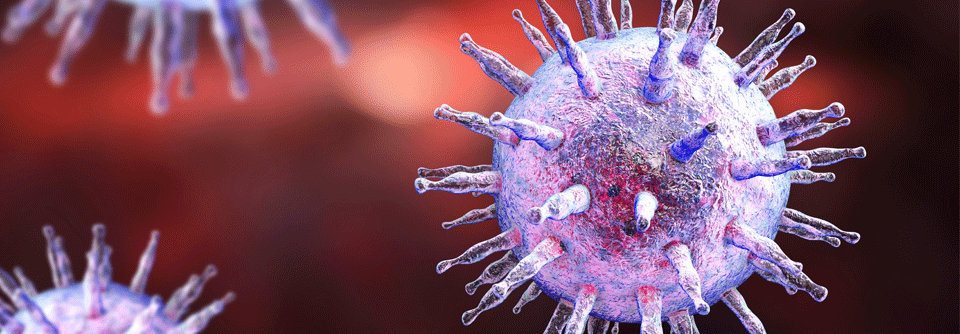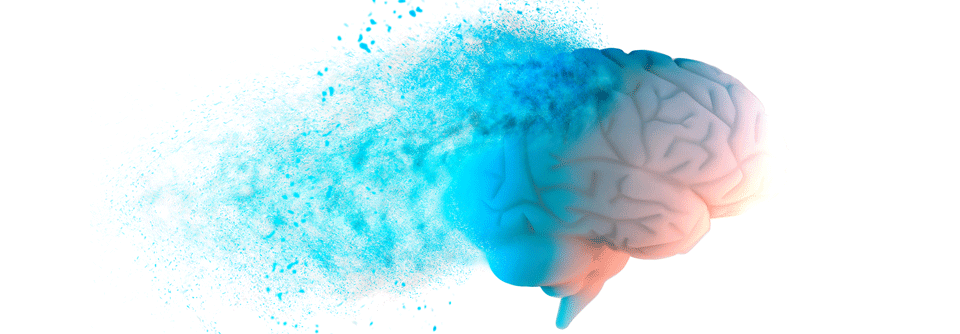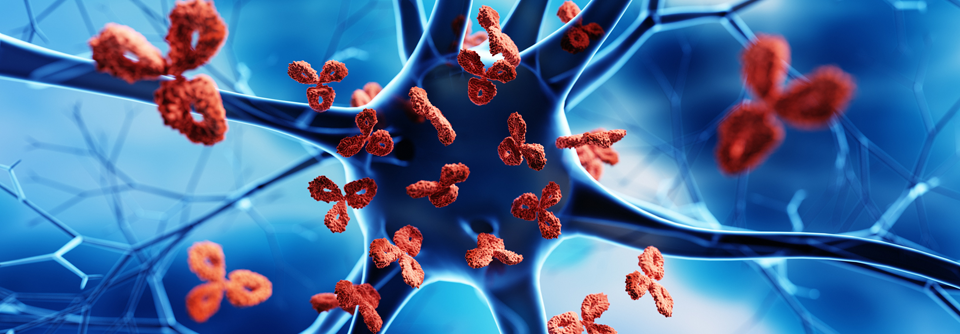Long-COVID Antineuronale Antikörper auch im Spiel
 Auch bei einer schweren COVID-19-Infektion treten neurologische Symptome auf.
© Yuliia – stock.adobe.com
Auch bei einer schweren COVID-19-Infektion treten neurologische Symptome auf.
© Yuliia – stock.adobe.com
Nicht jeder gegen körpereigene Proteine gerichtete Antikörper, der sich in Blut oder Liquor nachweisen lässt, ist es wert, dass man sich eingehend mit ihm beschäftigt. „Klinisch relevant werden Autoantikörper dann, wenn ein dazu passendes typisches klinisches Bild vorliegt“, sagte Prof. Dr. Harald Prüß von der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Noch besser, wenn der Antikörper nachweislich pathogen ist und das Krankheitsbild reproduzierbar auf eine Immuntherapie anspricht.
Selbst Spezialisten behalten nur schwer den Überblick
Mit Riesenschritten kommt die Forschung voran, dutzende Antikörper wurden in den letzten Jahren identifiziert, die Autoimmun-Enzephalitiden auslösen können. Alle paar Monate kommen weitere hinzu – selbst für Spezialisten wird es schwer, den Überblick zu behalten. Quasi den Startschuss gab die Entdeckung, dass Autoantikörper gegen Aquaporin-4 an der Entstehung der Neuromyelitis optica beteiligt sind. Es folgte der Nachweis von Antikörpern gegen NMDA-Rezeptoren, oft zu finden bei jungen Frauen mit Ovarialteratomen im Sinne einer Paraneoplasie. Bevor es gelang, diese Antikörper im Liquor zu detektieren, standen Neurologen oft ratlos vor den Patientinnen, die häufig von den Psychiatern überwiesen wurden mit polymorph-psychotischen Störungen und Krampfanfällen. Viele lagen lange im refraktären Status epilepticus auf der Intensivstation, weil nicht klar war, dass eine Immuntherapie ihren Zustand beenden könnte.
Ein weiterer klinisch relevanter Autoantikörper richtet sich gegen das zelluläre Adhäsionsmolekül Caspr2 und findet sich bei der Limbischen Enzephalitis mit Insomnie, psychiatrischen, neuroendokrinen und Gedächtnisstörungen. Häufig kommt es zur Neuromyotonie mit unwillkürlicher spontaner Muskelaktivität vor allem an den Extremitäten. Zu den Auslösern der Limbischen Enzephalitis zählen ferner Autoantikörper gegen LGI1. Liegen sie vor, sind faziobrachiale dystone Krampfanfälle fast schon pathognomonisch.
Auch bei vielen Patienten mit schwerer COVID-19 sehen die Neurologen im Verlauf Komplikationen wie Hyperexzitabilität, Epilepsie, Myoklonien und prolongiertes Delir. „Wir haben bei allen Patienten Antikörper gegen Hirngewebe, gegen Endothel, gegen Neuropil in Bulbus olfactorius oder Hippocampus, gegen Körnerzellen im Kleinhirn oder gegen Astrozyten gefunden“, berichtete Prof. Prüß. Er vermutet, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um pathogene Antikörper handelt.
Die MRT hilft diagnostisch oft nicht weiter
Der Beweis muss jedoch Antikörper für Antikörper geführt werden, um zu verstehen, ob COVID-assoziierte und Long-COVID-assoziierte Symptome durch sie ausgelöst werden können. Immerhin gibt es bereits Fallberichte, dass psychotische Symptome bei Autoantikörper-positiven Patienten mit SARS-CoV-2-Infektion durch eine Behandlung mit intravenösen Immunglobulinen in Remission kamen.
Die Bildgebung mittels Kernspintomographie, sonst eine der wichtigsten Methoden, hilft bei Autoimmunenzephalitiden häufig nicht weiter, weil das Bild auch bei schwersten Hirnerkrankungen lange unauffällig bleibt, erklärte Prof. Prüß. Mittlerweile gibt es verfeinerte MRT-Techniken, z.B. funktionelle Resting-State- oder Netzwerkuntersuchungen, die stadienabhängig und sogar antikörperabhängig relativ typische Befunde zeigen.
Sie sind noch nicht Teil der klinischen Routine, könnten es aber in einigen Jahren werden. An der Charité ist außerdem eine Pipeline implementiert worden, mit der sich Antikörper aus B- und Plasmazellen isolieren und in nahezu unbegrenzter Menge nachbauen lassen. Dies ermöglicht im Tierversuch zu prüfen, ob der Antikörper pathogen ist und sich der Versuch einer Immuntherapie, B-Zelldepletion oder Apherese lohnt.
Quelle: 94. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie – Live. Interaktiv. Digital