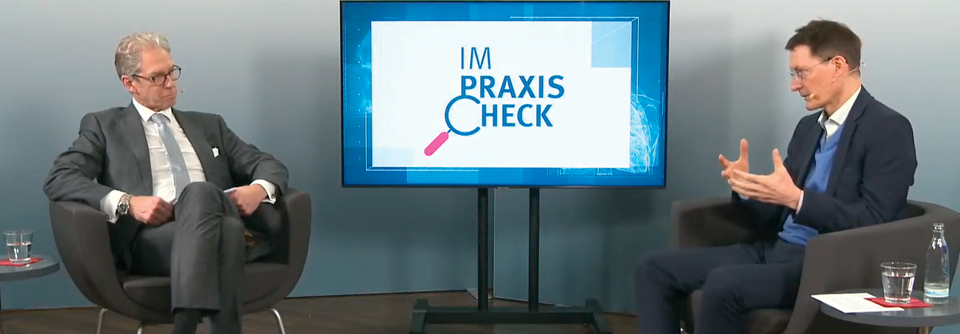Isolation und Depression Die Pandemie der Einsamkeit
 In der Pandemie leiden vor allem Frauen unter Einsamkeit und Depressionen.
© Science Photo Library/ Gary Waters/Ikon Images
In der Pandemie leiden vor allem Frauen unter Einsamkeit und Depressionen.
© Science Photo Library/ Gary Waters/Ikon Images
Der Mensch ist ein soziales Wesen und die soziale Integrität ist ebenso wichtig wie die körperliche. Das zeigt sich bei der Betrachtung von Einsamkeit und Mortalität, erklärte Prof. Dr. Manfred Spitzer, Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III am Universitätsklinikum Ulm. Gute, belastbare soziale Beziehungen verbessern die Überlebenswahrscheinlichkeit um 50 % – unabhängig von Alter, Geschlecht, ursprünglichem Gesundheitszustand oder betrachteten Todesursachen. Dagegen erhöht soziale Isolation das Mortalitätsrisiko um 29 %, Einsamkeit um 26 % und Alleinleben um 32 %.
Chronische Stressreaktion durch Vereinsamung?
Einsamkeit muss laut Prof. Spitzer als mindestens ebenso wichtiger Risikofaktor für Mortalität betrachtet werden wie Rauchen, Alkoholkonsum, mangelnde körperliche Aktivität, Übergewicht oder unbehandelter Bluthochdruck. Eine mögliche Ursache für die Assoziation von Vereinsamung und Sterblichkeit könnte eine chronische Stressreaktion sein, die die Entstehung beispielsweise von Diabetes, Hypertonie, Infektionen oder Krebs begünstigt.
In der COVID-19-Pandemie gaben insbesondere jüngere Menschen an, sich durch die Coronamaßnahmen häufig oder sogar jeden Tag einsam oder isoliert zu fühlen. Auch dieser Stress schwächt nach Aussage von Prof. Spitzer die Immunabwehr und begünstigt SARS-CoV-2-Infektionen. Schon vor Jahren habe man den dosisabhängigen Effekt von psychischem Stress auf die Empfindlichkeit für akute Atemwegsinfektionen belegen können – auch solche, die von Coronaviren ausgelöst wurden.
Aktuelle Daten weisen darauf hin, dass Menschen, die einen erhöhten psychischen Distress in der aktuellen Pandemie angaben, sich häufiger mit SARS-CoV-2 infizierten und mehr Symptome entwickelten. Prof. Spitzer bedauerte, dass niemand im ersten Lockdown 2020 solche Aspekte diskutiert habe – es hätten eben nur Virologen und Epidemiologen in den Entscheidungsgremien gesessen.
Weltweit wird seit Beginn der Pandemie eine starke Zunahme von Einsamkeit und Depression verzeichnet. Anstiege gab es in allen Altersgruppen, der Unterschied war aber besonders groß bei jungen Menschen und bei Frauen. Insgesamt wird für 2020 mit einer Zunahme der Major Depression von 53,2 Millionen Fällen ausgegangen, bei Angststörungen geht man von einem Plus von 76,2 Millionen Fällen aus, berichtete Dr. Moritz Elsaeßer von der Universität Freiburg.
Deutschland ist nach seiner Aussage mit einer Zunahme der Prävalenz der Major Depression um 15 % noch relativ gut durch die Pandemie gekommen.
Frauen wurden häufiger depressiv als Männer
Nach Ergebnissen des sozioökomischen Panels (SOEP) nahm hierzulande vor allem im ersten Pandemiejahr die Depressivität – erfasst anhand des Patient Health Questionnaire-4 (PHQ-4) – stark zu, im zweiten Jahr dann wieder etwas ab. Auch in SOEP zeigte sich eine deutliche Diskrepanz zwischen Männern und Frauen. Letztere berichteten 2020 deutlich häufiger über Depressivität, die 2021 auch nur wenig abnahm.
Daten zur Einsamkeit hat man in dem Panel in den Jahren 2017, 2020 sowie 2021 erhoben. Die Auswertung ergab in der Pandemie eine deutliche Zunahme in allen Altersgruppen – bei Frauen wiederum noch mehr als bei Männern. Menschen mit vorbestehenden Depressionen waren bereits vor der Pandemie einsamer als diejenigen ohne eine solche Diagnose. Letztere klagten in der Pandemie jedoch noch häufiger über Einsamkeit als Menschen mit vorbestehender Depression.
Die Pandemie wurde zu einer Pandemie der sozialen Isolation, sagte Dr. Elsaeßer. Es bleibt abzuwarten, welche Folgen das „neue Normal“ mit Homeoffice und überwiegend virtuellen Kontakten sowie mit der Digitalisierung in allen Lebensbereichen für Gesundheit und Gesellschaft haben wird.
Kongressbericht: DGPPN Kongress 2021 (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunden)