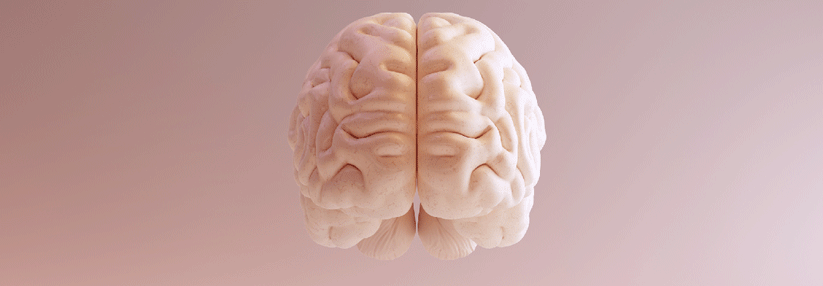Psychose: Patienten mit hohem Risiko besser identifizieren
 Wie können Hausärzte Patienten mit hohem Risiko besser identifizieren?
© kai – stock.adobe.com
Wie können Hausärzte Patienten mit hohem Risiko besser identifizieren?
© kai – stock.adobe.com
Sie sind jung, meist männlich und leiden unterschwellig schon länger an psychotischen Symptomen. Kommen noch ungünstige Lebensverhältnisse und psychische Komorbiditäten hinzu, ist die Checkliste komplett. Laut Literatur ist das typisch für Personen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das Vollbild einer Psychose entwickeln werden. Und in der Tat zeigen 85 % von ihnen bereits seit mehr als einem Jahr psychosenahe Vorläufersymptome, bevor sie das ersten Mal auf einen Psychiater treffen.
Im Schnitt liegt das Alter der Betroffenen bei 21 Jahren, 58 % sind männlich, schreiben Professor Dr. Paolo Fusar-Poli vom King’s College und Kollegen nach der Auswertung von 42 Metaanalysen. Risikopersonen sind besonders häufig körperlich inaktiv, haben geburtshilfliche Komplikationen hinter sich und leben mit einer olfaktorischen Einschränkung. Ihr Bildungsstand ist eher niedrig, oft haben sie keine Anstellung und leben alleine.
Rat zur kognitiven Verhaltenstherapie
Verschiedene Traumaerfahrungen sind bei ihnen häufiger zu finden und schwerer ausgeprägt als in Kontrollgruppen. Psychoserisikopersonen rauchen öfter (33 %) oder konsumieren Cannabis (27 %), sie haben ungewöhnliche Gedankeninhalte und sind eher misstrauisch. Depressionen und Angststörungen sind bei ihnen ebenfalls häufiger zu finden (41 bzw. 15 %). Zwei Drittel von ihnen haben schon an Suizid gedacht (66 %), jeder Zweite hat sich bereits selbst verletzt (49 %) und fast jeder Fünfte hat bereits einen Suizidversuch unternommen (18 %). Häufigere funktionelle Einschränkungen im Alltag zeigten sich bei diesen Personen schon in Kindheit und Jugend, die Lebensqualität ist schlechter als bei Kontrollpersonen und vergleichbar mit der von erwiesenen Psychotikern.
Die Prognosestellung gelingt laut den Autoren mit semistrukturierten Interviews relativ gut. Unklar ist, ob diese Instrumente auch außerhalb von spezialisierten Kliniken anwendbar sind. Als Prädiktoren für den Progress zu einer Psychose dienen primär die Schwere der attenuierten Positivsymptome und eine schlechte Funktionsfähigkeit im Alltag sowie eine bestehende Negativsymptomatik.
Evidenz für die Überlegenheit einer bestimmten Intervention gibt es bislang nicht. Das soll aber nicht heißen, dass nicht auf den individuellen Bedarf abgestimmte Maßnahmen ergriffen werden sollten, betonen die Autoren. Primär empfehlen sie eine kognitive Verhaltenstherapie oder psychologische Interventionen, die bei Bedarf mit weiteren Interventionen verstärkt werden können. Eine Übertherapie von Patienten mit unterschwelligen Symptomen sei das nicht, schreiben Professor Dr. Patrick D. McGorry und Professor Dr. Barnaby Nelson von der Universität von Melbourne in einem begleitendem Kommentar. Das würden die in der Auswertung belegte Morbidität und die deutlich eingeschränkte Lebensqualität der Betroffenen bestätigen.
Frühsymptome fehlen bei jedem Dritten
Die fehlende Evidenz für Faktoren, die ein Erkennen von Risikopersonen im allgemeinärztlichen Bereich ermöglichen, bleibt ein Problem. Bislang werden erst 5–12 % der Menschen mit psychotischen Frühsymptomen entdeckt. Allerdings finden sich bei einem Drittel der Psychosepatienten vor der ersten Episode keinerlei Hinweise, die auf eine erhöhte Psychosegefahr deuten. Die Erwartungen ruhen nun auf neuen Modellen, mit denen sich aus der Fülle der Risikofaktoren diejenigen identifizieren lassen sollen, die für das Erkennen einer besonderen Gefährdung Bedeutung haben.
Quellen:
1. Fusar-Poli P et al. JAMA Psychiatry 2020; DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2019.4779
2. McGorry PD, Nelson B. A.a.O.; DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2019.4635