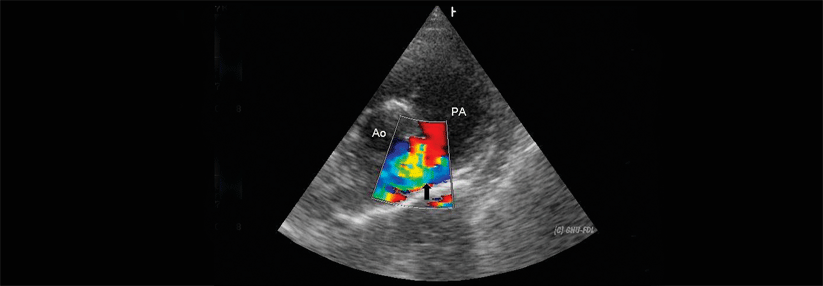Fetale Alkoholspektrumstörung Von Geburt an chronisch krank
 Bereits eine einzige Flasche Bier ist bedenklich. Während der gesamten neun Schwangerschaftsmonate gilt grundsätzlich eine Null-Promille-Grenze.
© adragan – stock.adobe.com
Bereits eine einzige Flasche Bier ist bedenklich. Während der gesamten neun Schwangerschaftsmonate gilt grundsätzlich eine Null-Promille-Grenze.
© adragan – stock.adobe.com
Die Fetalen Alkoholspektrumstörungen (FASD) stellen die häufigste schon bei der Geburt vorhandene chronische Erkrankung dar. Schätzungen zufolge sind fast 18 Kinder pro 1000 Lebendgeborene davon betroffen. Es kann so gut wie jedes Organ betroffen sein, im Vordergrund stehen aber Störungen des Gehirns. Einen Grenzwert, unterhalb dessen „das Gläschen in Ehren“ mit Sicherheit keine Beeinträchtigung des Fetus hervorruft, existiert nicht. Daher gelten für die gesamten neun Monate grundsätzlich null Promille, schreiben Dr. Judith Moder vom Dr. von Haunerschen Kinderspital am LMU Klinikum München und ihre Kollegen.
Die FASD umfassen
- das Fetale Alkoholsyndrom (FAS),
- das partielle Fetale Alkoholsyndrom (pFAS) und
- die alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung.
Einen genauen Überblick über die jeweiligen diagnostischen Kriterien gibt die Tabelle.
| Diagnose der Fetalen Alkoholspektrumstörungen | |
|---|---|
| Diagnostik | Erläuterungen |
| Fetales Alkoholsyndrom (FAS) | |
| Wachstumsstörungen |
|
| Auffälligkeiten der Gesichtszüge |
|
| Störungen des Zentralnervensystems |
|
| intrauterine Alkoholexposition | wenn Kriterien aus allen drei Kategorien vorliegen, gilt die Diagnose FAS als sicher, auch wenn der Alkoholkonsum der Mutter nicht bestätigt ist |
| Partielles Fetales Alkoholsyndrom (pFAS) | |
| Auffälligkeiten der Gesichtszüge | zwei der drei beim FAS genannten Kriterien |
| Störungen des Zentralnervensystems | mind. drei der folgenden Faktoren:
|
| intrauterine Alkoholexposition | für eine Diagnose sollte ein Alkoholkonsum der Mutter bestätigt oder wahrscheinlich sein |
| Alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung (Alcohol-related Neurodevelopmental Disorders, ARND) | |
| Störungen des Zentralnervensystems | mind. drei Auffälligkeiten wie beim pFAS |
| intrauterine Alkoholexposition | für eine Diagnose sollte ein Alkoholkonsum der Mutter bestätigt sein |
Viele leiden an Depressionen und Substanzabhängigkeiten
Die FASD sind nicht heilbar. Und auch wenn sich die morphologischen Auffälligkeiten ab dem Jugendalter zurückbilden können: Die ZNS-Schäden bleiben. Die Betroffenen haben oft Schwierigkeiten, ihren Alltag zu strukturieren und selbstständig zu leben. Dazu kommen häufig Depressionen, Substanzabhängigkeiten und Suizidverhalten.
Daher stellt die universelle (Primär-)Prävention einen der Hauptpfeiler dar, an dem man angreifen kann. An allererster Stelle steht die Aufklärung. Das gilt zum einen für die gesamte Bevölkerung. Geeignet sind etwa Flyer und andere Infomaterialien in Arztpraxen (siehe Link), Warnhinweise auf alkoholhaltigen Produkten und Aufklärungskampagnen in den Massenmedien. Im Idealfall würden diese Informationen bereits in der Schule vermittelt. Dort sind sie bislang aber i.d.R. nicht angekommen.
Daneben spricht die selektive Prävention Schwangere an, vor allem wenn ein riskanter Alkoholkonsum bekannt ist oder sie schon früher ein Kind mit FASD zur Welt gebracht haben. Einen riskanten Konsum zeigt beispielsweise der T-ACE-Fragebogen auf:
- T („tolerance“): Toleranzentwicklung
- A („felt annoyed“): Dem Umfeld fiel der Konsum bereits als störend auf
- C („cut down“): Versuche, den Konsum einzuschränken
- E („eye opener“): Alkohol wird schon am Morgen getrunken
Schwangerschaftsberatungsstellen, Praxen von Geburtshelfern und Hebammen stehen an vorderster Front, um diese Patientinnen frühzeitig zu erkennen und aufzuklären – und die Beratung im Mutterpass zu vermerken.
Trinkt eine Schwangere trotz allem weiter, kann man Kurzinterventionen anbieten. Eventuell lässt sich eine ambulante oder stationäre Suchttherapie nicht vermeiden. Internetangebote stellen eine Option dar, der Frauen möglicherweise mit weniger Hemmungen begegnen, und die sie außerdem von zu Hause aus nutzen können, gerade wenn Fachkräfte in der näheren Umgebung nicht verfügbar sind.
Die Sekundärprävention soll dazu beitragen, dass eine FASD so bald wie möglich diagnostiziert wird und das Kind und die Familie adäquate Hilfe erhalten – und zwar langfristig. Die Tertiärprävention schließlich soll Folgeschäden und sekundäre Erkrankungen vermeiden, z.B. die oben geschilderten psychiatrischen Probleme.
Quelle: Moder J et al. Bundesgesundheitsbl 2021; 64: 747-754; DOI: 10.1007/s00103-021-03329-6