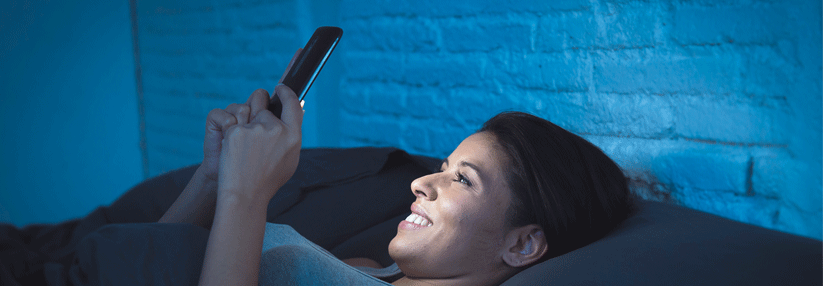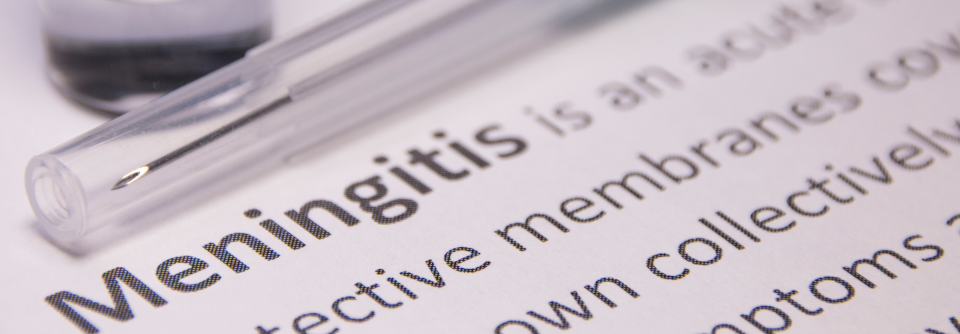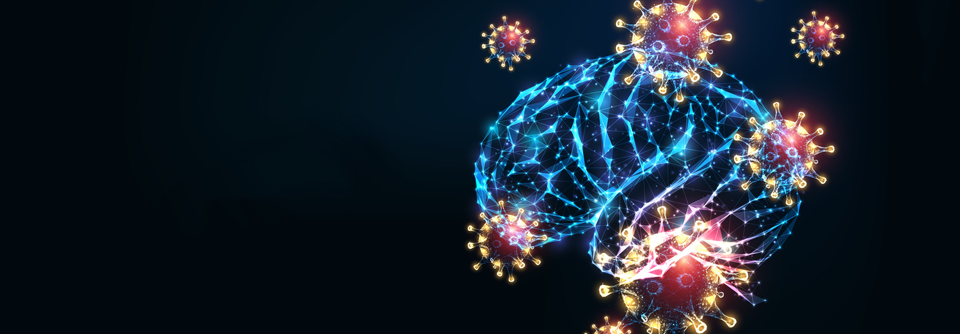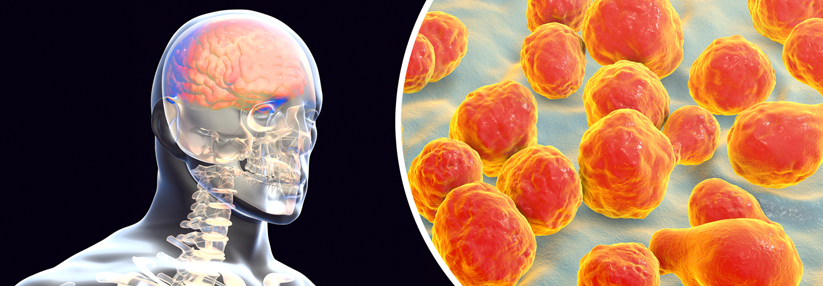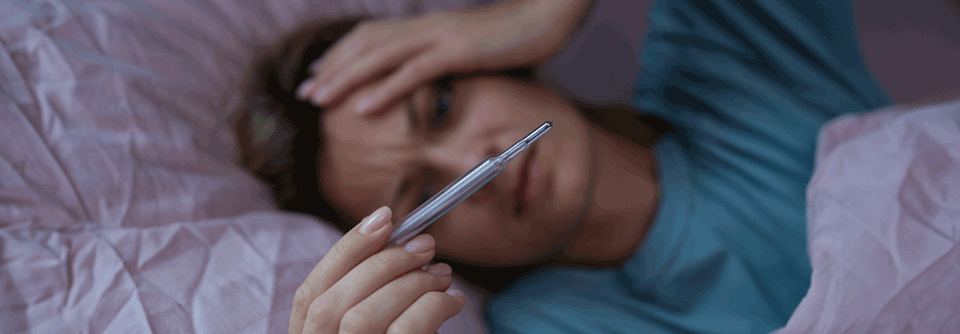Bei Verdacht auf Meningitis schleunigst Antibiotika geben
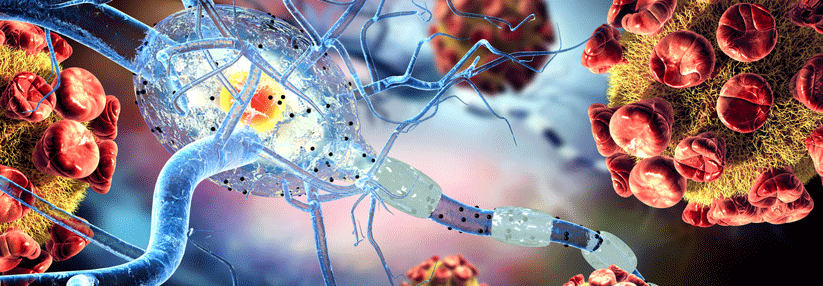 Nicht erst abwarten, bis der Erregernachweis erfolgt ist!
© fotolia/ralwel
Nicht erst abwarten, bis der Erregernachweis erfolgt ist!
© fotolia/ralwel
Die bakterielle Meningitis tritt bei Erwachsenen zwar selten auf, kann aber vor allem im Falle einer verzögerten Diagnose und Therapie fatale Konsequenzen haben, schreiben Dr. Sebastian von Arx, Zentrum für Seh- und Wahrnehmungsstörungen, Universitätsklinik für Neurologie, Inselspital Bern, und Kollegen. Das Problem: Nicht immer stellt sich der Patient mit der klassischen Trias Fieber, Kopfschmerzen und Nackensteifigkeit vor.
Im Erregerspektrum dominiert mit einer Häufigkeit von 50 % Streptococcus pneumoniae, gefolgt von Neisseria meningitidis (25 %). Diese septischen Meningitiden kommen allerdings deutlich seltener als die viralen z.B. durch Entero- oder FSME-Virus ausgelösten Varianten vor.
Hirnhautentzündung bereitet nicht immer Kopfschmerzen
Leitsymptom der bakteriellen Meningitis im Frühstadium ist meist persistierender Kopfschmerz – aber eben nicht immer. Das gilt z.B. für die Borrelienmenigitis, die i.d.R. subakut verläuft. Bei einer rasch progredienten klassischen bakteriellen Meningitis mit Bewusstseinseintrübung kann der Patient außerdem oftmals keine Angaben über Kopfschmerzen machen. In Studien besaßen 95 % der Betroffenen mindestens zwei von diesen drei klar identifizierbaren Symptomen: Fieber, Meningitis, veränderter Mentalstatus.
Eine diagnostische Herausforderung stellen Senioren dar aufgrund vermehrter atypischer Präsentationen. Ein sich plötzlich verschlechternder Allgemeinzustand gibt in diesen Fällen den Hinweis auf eine bakterielle Meningitis. Umgekehrt legt eine anhaltend gute Verfassung eine viral bedingte Erkrankung nahe, erklären die Autoren.
Die Mortalitätsrate liegt bei 10–30 %
Besteht der Verdacht auf eine bakterielle Meningitis, bilden Blutkultur und Lumbalpunktion zur Liquorgewinnung die wichtigsten diagnostischen Maßnahmen. Die Indikation für letztere kann durchaus großzügig gestellt werden. Bei krankheitsbedingt instabilem Kreislauf, schweren Gerinnungsstörungen und Zeichen eines erhöhten Hirndrucks ist allerdings Zuwarten ratsam. Das darf jedoch nicht vom Therapiestart abhalten: Auch bei noch unbekanntem Erreger sollten Kollegen spätestens 60 Minuten (vorzugsweise 30 Minuten) nach Abnahme der Blutkulturen die Therapie mit Antibiotika ggf. plus Steroiden beginnen. Nur so lassen sich Komplikationen und Letalität vermindern, ermahnen die Experten. Die Mortalitätsrate liegt bei 10–30 %.
Die empirische Antibiotikagabe orientiert sich am Alter des Patienten und den prädisponierenden Erkrankungen: Bei nicht geimpften Erwachsenen mit vermuteter Pneumokokken- und Meningokokken-Infektion kommt ein Cephalosporin der dritten Generation wie Ceftriaxon zum Einsatz. Je nach lokaler Epidemiologie evt. zusätzlich Vancomycin oder Rifampicin zur Abdeckung von ceftriaxonresistenten Pneumokokken. Personen über 50 Jahre oder mit Risikofaktoren wie Schwangerschaft sowie medikamentös oder durch Diabetes und Alkoholmissbrauch bedingter Immunsuppression sollten eine zusätzliche empirische Anti-Listerien-Antibiose erhalten. Die Therapie läuft bei Meningokokken über sieben Tage, bei Pneumokokken bzw. bei fehlendem Keimnachweis über 14 Tage und bei Listerien über 21 Tage. Abweichungen sind jedoch möglich, betonen die Schweizer Kollegen.
Intravenöse Steroide können die Nerven bewahren
Vor allem zur Prävention neurologischer Schäden durch körpereigene Entzündungsmediatoren empfiehlt sich die additive intravenöse Steroidgabe, optimalerweise unmittelbar vor oder während der ersten Antibiotikaeinnahme. Klinische Studien ergaben in der kumulativen Evidenz eine Mortalitätsreduktion für die Pneumokokken-Meningitis. Die Experten der Leitlinien raten deshalb zum empirischen Einsatz z.B. von 10–12 mg Dexamethason i.v. alle sechs Stunden über vier Tage bzw. bis zum Nachweis eines Nicht-Pneumokokken-Erregers.
Langzeitschäden bei jedem zweiten bis dritten Patienten
Für niedergelassene Kollegen außerdem wichtig: Rund 30–50 % der Patienten entwickeln nach einer bakteriellen Meningitis Langzeitschäden. Dazu gehören vor allem Gehörverlust, neuropsychologische Störungen und fokale neurologische Ausfälle. Mit einer gezielten Suche lassen sich vor allem bei beginnendem Hörverlust mögliche funktionelle Defizite zum Beispiel durch ein Cochleaimplantat auffangen.
Quelle: von Arx S et al. Swiss Medical Forum 2017; 17: 464-470
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).