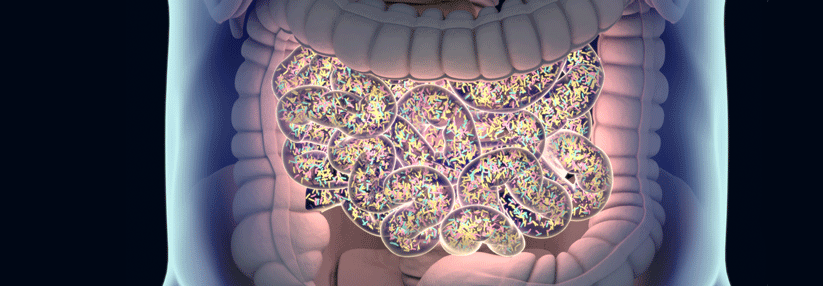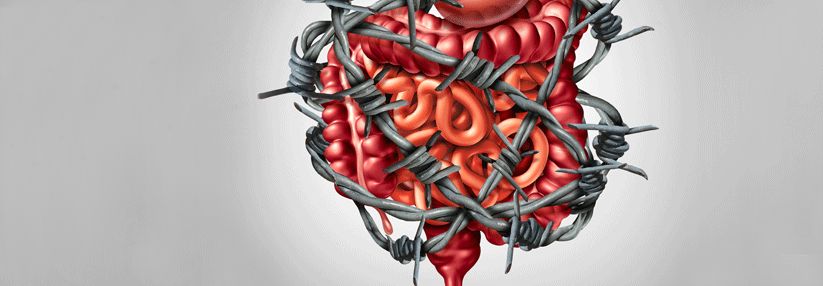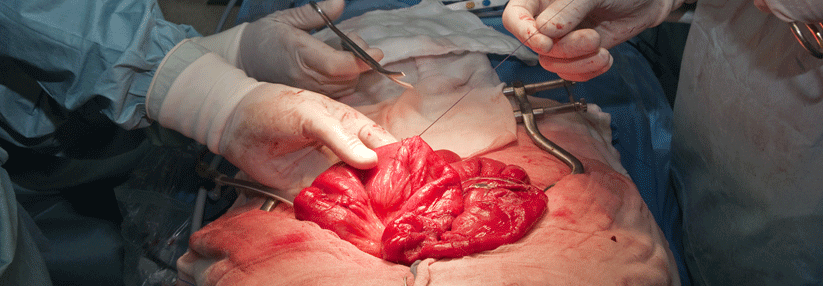Reizdarmsyndrom: Barbaren in Rom
 Konsensuskriterien zum Reizdarm bereiten manchen Experten Bauchschmerzen.
© fotolia/Wellnhofer Designs
Konsensuskriterien zum Reizdarm bereiten manchen Experten Bauchschmerzen.
© fotolia/Wellnhofer Designs
Professor Dr. Paul Enck aus Tübingen*, Professor Dr. Thomas Frieling aus Krefeld** und Professor Dr. Michael Schemann aus München*** zählen zu den Prominenten unter den deutschen Neurogastroenterologen. In ihrer Publikation wollen sie gar nicht abstreiten, dass es das Reizdarmsyndrom (RDS) gibt. Was ihnen aber Bauchschmerzen bereitet, ist der wissenschaftliche Umgang damit. Denn der führt dazu, dass es weiter an vernünftiger Definiton, Diagnostik und Therapie mangelt. Dabei nehmen die Fachmänner sich selbst nicht aus.
„Den Hausarzt interessiert Rom herzlich wenig“
„Funktionelle Magen-Darm-Störungen“ dürften wohl schon immer existieren und Namen gab es auch einige dafür, z.B. irritables Kolon oder nervöser Darm. Doch ab etwa 1990 schickten sich laut den Autoren „selbsternannte Experten“ an, die Kennzeichen dafür zu standardisieren. Ihr Treffpunkt war und blieb Rom und so wurde aus ihnen die Rom-Konsensus-Kommission mit den Rom-Kriterien. Das Ergebnis Stand heute: Fünf Auflagen, 32 verschiedene funktionelle Erkrankungen. „Die Barbaren sind nicht vor den Toren Roms, sondern bereits drinnen“, so der Kommentar von Prof. Enck und Kollegen.
Die Problematik zeigt sich schon bei der Inzidenz. 50 Fragen des Rome-Modular-Questionnaire muss man beantworten, um die Häufigkeit des RDS zu ermitteln. Und die Zahl der Erkrankten schwankte mit jeder Weiterentwicklung der Kriterien erheblich. Noch während die Patienten in den Wartezimmern auf Therapien warten, hätten sie die Diagnose bereits wieder verloren, moniert das Trio.
Wann wird aus Beschwerden eine Krankheit?
In der Praxis landen die Patienten in erster Linie beim Allgemeinmediziner und nicht beim Gastroenterologen. Und den interessieren Rom und seine Ergüsse herzlich wenig. Er schließt relevante organische Krankheiten aus (zu denen er das RDS übrigens selten zählt) und behandelt pragmatisch und symptomorientiert.
Besser auf Frust einstellen, statt Hoffnung zu machen
Pharmakologisch verliefen bislang ohnehin alle Ansätze enttäuschend. Kleine Medikamentenwirkungen bei großen Placeboeffekten: So lassen sich die Entwicklungen zusammenfassen. Einen Blockbuster darf man wahrlich nicht erwarten, es handelt sich eben nicht um eine einheitliche Krankheitsentität.In den 1980er-Jahren waren sich Prof. Frieling und Prof. Enck sicher, die Auflösung des Rätsels RDS noch zu erleben. Die Hoffnung trog und so bleibt ihnen heute nicht viel, außer die Nachfolgenden auf den kommenden Frust vorzubereiten.
* Innere Medizin VI am Universitätsklinikum
** Medizinische Klinik II am Helios Klinikum
*** Lehrstuhl für Humanbiologie der Technischen Universität
Quelle: Enck P et al. Z Gastroenterol 2017; 55: 679-684
Falls Sie diesen Medizin Cartoon gerne für Ihr nicht-kommerzielles Projekt oder Ihre Arzt-Homepage nutzen möchten, ist dies möglich: Bitte nennen Sie hierzu jeweils als Copyright den Namen des jeweiligen Cartoonisten, sowie die „MedTriX GmbH“ als Quelle und verlinken Sie zu unserer Seite https://www.medical-tribune.de oder direkt zum Cartoon auf dieser Seite. Bei weiteren Fragen, melden Sie sich gerne bei uns (Kontakt).