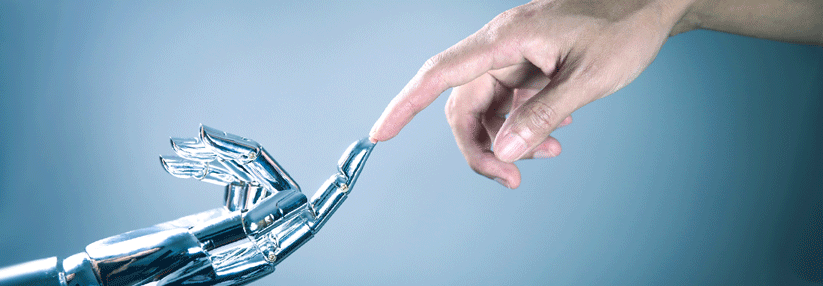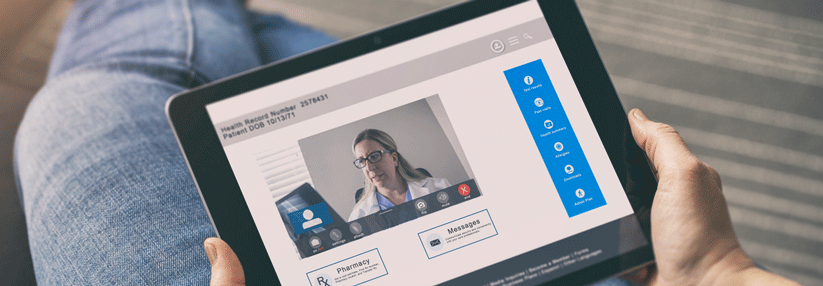
Auf dem Weg zur digitalen Psychotherapie?
 Videosprechstunden sind anstrengend, haben aber Zukunftspotenzial, sagen viele Psychotherapeuten.
© Abdul Qaiyoom – stock.adobe.com
Videosprechstunden sind anstrengend, haben aber Zukunftspotenzial, sagen viele Psychotherapeuten.
© Abdul Qaiyoom – stock.adobe.com
Dr. Hennemann arbeitet in der Abteilung für Klinische Psychologie, Psychotherapie und Experimentelle Psychopathologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Die Digitalisierung lässt sich insbesondere an zwei aktuellen Entwicklungen beobachten, sagt der Psychologische Psychotherapeut.
Erstens: Wegen der COVID-19-Pandemie haben Psychotherapeuten vielfach von Präsenzkontakten auf Videosprechstunden umgestellt. Eine Umfrage der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung unter knapp 4500 Psychotherapeutinnen und -therapeuten im April 2020 ergab allerdings, dass 73 % die Videosprechstunde für „weniger wirksam“ als die direkte Therapie erachteten. Die Hälfte fand sie „anstrengend“. Immerhin meinten 57 %, sie würden die Videosprechstunde künftig weiter nutzen.
Nachgewiesene Wirksamkeit von Internetinterventionen
Zweitens: Mit den sog. Digitalen Gesundheitsanwendungen, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft und seit Oktober für die Verordnung auf Kassenrezept gelistet werden, wird im deutschen Gesundheitswesen Neuland betreten. Welchen nachhaltigen Effekt das für die Versorgung psychischer Störungen haben wird, bleibt abzuwarten.
Internetinterventionen sind dahingegen nicht neu und für fast alle psychischen Störungen untersucht worden, vor allem als begleitete Selbsthilfe, berichtet Dr. Hennemann. Die Studien zeigten überwiegend positive Wirksamkeitsnachweise dieser Programme. Die Begleitung erfolge häufig asynchron, d.h. über Textnachrichten oder therapeutisches Feedback, und sei eher als Zusatzangebot mit dem Ziel der Förderung der Adhärenz bzw. des Selbstmanagements der Nutzer zu verstehen.
Der Wissenschaftler nannte in seinem Online-Vortrag bei der Tagung der beiden AGs Beispiele für digitale Angebote. So könne etwa bei leichter bis mittelgradiger Depression die begleitete Selbsthilfe „iFightDepression“ empfohlen werden, „gerade da diese von Ärzten und Psychotherapeuten betreut sein muss“. Sie basiert auf Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie und ist kostenlos in zwölf Sprachen verfügbar.
Gemeinsame virtuelle Tagung
Korrekte Diagnosen mithilfe von Chatbots und Algorithmen?
Auch Apps zu diagnostischen Zwecken sind im Kommen. Diese nutzen z.B. Chatbots, die dem Nutzer Fragen stellen; ein Algorithmus versucht, die Antworten entlang eines diagnostischen Pfades in diagnostische Empfehlungen zu übertragen. Wie gut kann eine solche App psychische Störungen erkennen? Das sei vom Benutzer und von der Diagnose abhängig, sagt Dr. Hennemann. In der Mainzer Therapieambulanz laufen dazu Untersuchungen. „Derzeit deuten zumindest unsere Studien darauf hin, dass eine Gesundheitsapp, bei der Patienten Symptome eingeben und sich erhoffen, mit hoher Sicherheit eine korrekte Diagnose zu bekommen, im Bereich psychischer Störungen vielleicht noch nicht so weit ist.“ Es sei durchaus denkbar, dass künstliche Intelligenz künftig nicht nur zur Diagnostik, sondern auch für therapeutische Funktionen und Entscheidungsprozesse genutzt werden könne. Bis zur Praxistauglichkeit dieser Technologien sei aber noch ein Weg zu gehen. Unbegleitete Programme und Apps hätten zudem oft hohe Abbruchraten, was bei Nutzern Frustration und Gefühle der Hilflosigkeit verstärken könne. Ein weiteres Problem sei ein unzureichender Datenschutz. Die Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsapps sei deshalb oft eingeschränkt. Vieles deute daher darauf hin, dass begleitete Interventionen unbegleiteten, d.h. reinen Selbsthilfeangeboten, noch vorzuziehen sind. Programme aus Forschungsprojekten sind bisher kaum bis gar nicht in der Regelversorgung angekommen, möglicherweise weil der Fokus vor allem auf Wirksamkeits- und weniger auf Effektivitätsstudien lag. Ein Fazit von Dr. Hennemann lautet daher: „Was gut beforscht ist, findet kaum den Weg in die Praxis, viele Forschungsprojekte landen wieder in der Schublade. Was für die Praxis angeboten wird, ist dagegen kaum gut beforscht.“ Vielversprechend für die Versorgungsrealität sei die Kombination von digitalen Tools mit Therapiesitzungen vor Ort, sog. Blended Psychotherapie. Bei einer Umfrage der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz gab nur jeder vierte Therapeut an, digitale Tools – selten bis häufig – zu nutzen. 65 % können sich allerdings eine künftige Nutzung „vorstellen“.Kompetenzerwerb in Sachen Digitalisierung ist zu fördern
Wichtig sei es, dass Patienten und Behandler auf Basis ihrer Erfahrungen und Erfordernisse die Digitalisierung aktiv mitgestalten. Dazu gehöre auch, deren Digitalkompetenzen zu fördern, damit sie Indikation, Qualität und Anwendung von digitalen Angeboten beurteilen und sich in diesem wachsenden Markt orientieren können.Quelle: Videomitschnitt der Tagung „Mensch und Technik“ 25.–27.9.2020