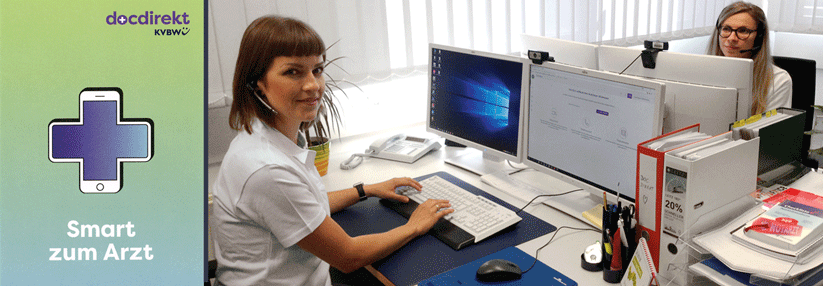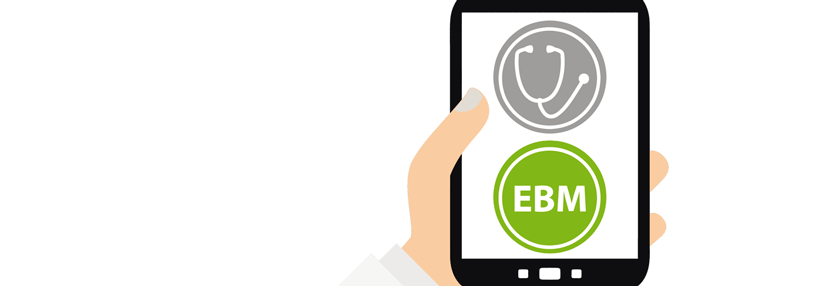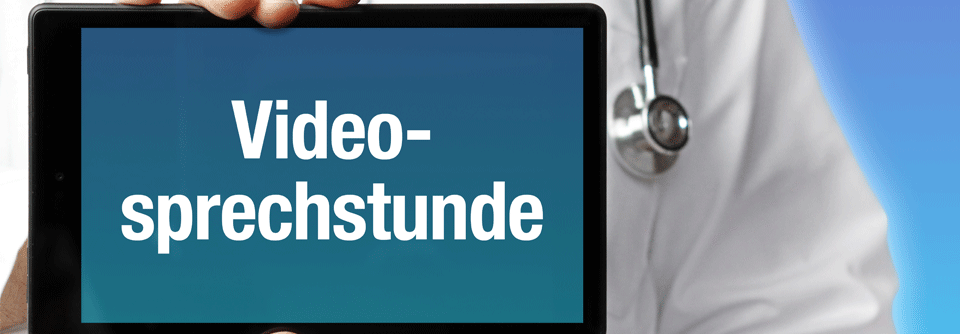Die Videosprechstunde soll's richten
 Telemedizin als Allheilmittel gegen Ärztemangel. Rechts: Hausarzt Dr. Gerd W. Zimmermann.
© Fotolia/ fotodesignart; privat
Telemedizin als Allheilmittel gegen Ärztemangel. Rechts: Hausarzt Dr. Gerd W. Zimmermann.
© Fotolia/ fotodesignart; privat
Telemedizin ist eigentlich gar nichts Neues. Bildgebende Verfahren werden schon lange ortsunabhängig vom Röntgen-, CT- oder MRT-Gerät befundet. Auch bei Labor-, Histologie- oder Zytologieleistungen kommt in der Regel kein Arzt-Patienten-Kontakt, aber trotzdem ein Ergebnis zustande.
In letzter Zeit ist Telemedizin aber vorwiegend im Zusammenhang mit dem Haus- oder Fachärztemangel in der Diskussion. Mittlerweile gibt es mehrere Modelle und Initiativen, die sich unter dem Oberbegriff „Telemedizin“ versammeln. Dabei handelt es sich meist aber um Maßnahmen, die in eine ganz andere Richtung gehen und das Thema eher atomisieren. Hausärzte sollen via technische Hilfsmittel über medizinische Hilfskräfte mit dem Patienten in Verbindung gebracht werden oder Fachärzte kontaktieren, ohne dass der Patient dort vorstellig wird.
Haupthindernis für die Installation eines medizinisch sinnvollen und betriebswirtschaftlich tragbaren Telemedizinsystems im ambulanten Bereich sind im Moment immer noch die finanziellen Rahmenbedingungen. Zwar gibt es im EBM seit knapp einem Jahr Abrechnungspositionen für eine Videosprechstunde. Die sind aber derart mit Ausnahmeregelungen belastet, dass eine Praxis es sich kaum leisten kann, so etwas anzubieten. Die Nr. 01439 EBM kann für die Betreuung eines Patienten in einer Videosprechstunde nur einmal im Quartal und nicht neben der Versichertenpauschale berechnet werden und wird mit lächerlichen 9,38 Euro vergütet. Selbst die Kostenübernahme nach Nr. 01450 ist auf aktuell 202,32 Euro im Quartal gedeckelt und garantiert damit keineswegs, dass in der Praxis wirklich alle anfallenden Kosten für eine Videosprechstunde abgedeckt sind.
Schöne Idee – von der viel zu wenige Patienten profitieren
In Hessen hat der Hausärzteverband mit der AOK einen Letter of Intent unterzeichnet, der vorsieht, dass im Rahmen eines nachfolgenden Vertrages Versorgungsassistentinnen (VERAH) in der hausarztzentrierten Versorgung (HzV) auf Hausbesuch mit einem Tablet und Geräten in einem Telemedizin-Rucksack ausgestattet werden, um von dort Vitaldaten der Patienten an die Praxis zu übermitteln. Die Daten werden in die Praxis-EDV übernommen und können so vom Hausarzt beurteilt werden.
Über die Finanzierung dieses Projektes scheint bisher keine Einigung erzielt worden zu sein, man hofft aber auf Fördermittel der Landesregierung für diese als innovative Nutzung der Telemedizin bezeichnete Initiative. Nur leider beteiligt sich keine andere Kasse an dem Projekt und der Patient muss in den HzV-Vertrag eingeschrieben ist. Von den rund 1,8 Mio. Versicherten der AOK Hessen sind derzeit aber nur 140 000 Patienten eingeschrieben.
In Thüringen ist man etwas weiter. Ähnlich wie in Hessen werden dort nicht-ärztliche Praxisassistentinnen (NäPa) mit einem Telemedizin-Rucksack ausgerüstet, der unter anderem ein 3-Kanal-EKG, ein Pulsoximeter und ein Spirometer beinhaltet. Die Daten werden genauso an die Praxis übermittelt und der Hausarzt kann sich bei Bedarf über Videotelefonie zuschalten. Vertragspartner ist auch hier zunächst nur die AOK Plus, teilnehmen können allerdings alle Versicherten und es besteht eine Vereinbarung, die an die erwähnte schlechte Honorierung der Videosprechstunde ausgleichend andockt. Für bis zu 50 Besuche im Quartal werden – zusätzlich zur NäPa-Vergütung – je Besuch 15 Euro gezahlt. Wird der Arzt per Videotelefonie zugeschaltet, kommen 8 Euro hinzu sowie weitere Vergütungen für eine Sturzrisikoanalyse, eine Gesundheitsbefragung und eine Wundanalyse.
Studienplätze für künftige Hausärzte reservieren!
Die Mietkosten für den Telerucksack in Höhe von 500 Euro im Quartal werden bis zu einer Höchstzahl von 150 Rucksäcken zur Hälfte von der Landesregierung übernommen.
Fazit: Zweifelsohne sind solche Projekte ein Weg, die drohende oder vorhandene hausärztliche Unterversorgung abzumildern. Will man den Hausärztemangel aber wirklich beseitigen, wird man mittel- und langfristig nicht um staatlich gelenkte Maßnahmen herumkommen. Und die müssen bereits am Beginn des Medizinstudiums ansetzen.
Nicht länger darf die Abiturnote darüber entscheiden, wer Medizin studieren darf, sondern der Zugang zum Studium muss von der späteren Tätigkeit abhängig gemacht werden. Ein Teil der Studienplätze muss für die hausärztliche Versorgung reserviert und Sanktionen müssen geschaffen werden für den Fall, dass sich ein Studienabgänger nach Staatsexamen und Approbation nicht für eine Mindestzeit an der medizinischen Versorgung der Bevölkerung beteiligt.
Eine Ausweitung der telemedizinischen Projekte im fachärztlichen Bereich ist hingegen entbehrlich, da hier die Durchgängigkeit zwischen stationärem und ambulantem Bereich für die Bevölkerung längst nicht ausgereizt ist.