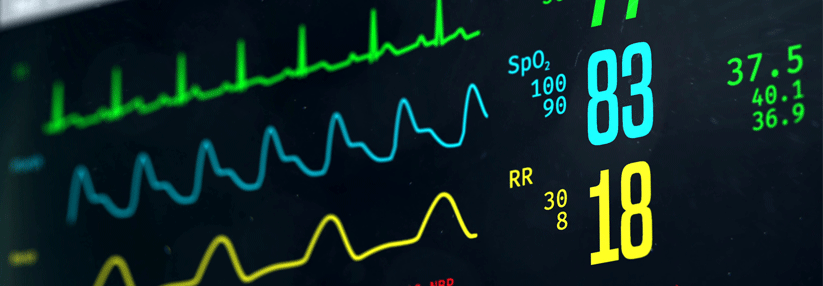Diagnostik von Panikstörungen und die Kommunikation mit den Patienten
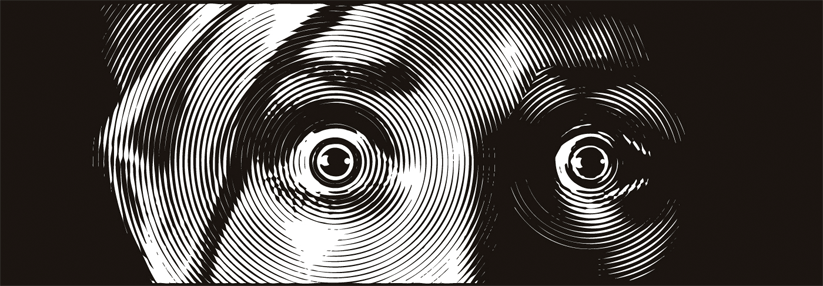 Wichtig ist zunächst, die manifeste Störung anahnd der verschiedenen Symptome von isolierten Panikattacken abzugrenzen.
© iStock.com/GeorgePeters
Wichtig ist zunächst, die manifeste Störung anahnd der verschiedenen Symptome von isolierten Panikattacken abzugrenzen.
© iStock.com/GeorgePeters
Während einer Panikattacke spüren die Betroffenen ein großes Unbehagen bis hin zur Todesangst. Gleichzeitig kommt es aber zu einer Vielzahl an vegetativ-somatischen Beschwerden (z.B. Palpitationen, Atemnot, Schweißausbrüche, Zittern), die die Patienten letztlich auf eine organische Ursache zurückführen und anschließend in Ihrer Praxis aufschlagen. Ihre Aufgabe ist es zunächst, einzelne Panikattacken von einer manifesten Panikstörung zu unterscheiden, schreiben Dr. David Kindermann und apl.-Professor Dr. Christoph Nikendei von der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik am Universitätsklinikum Heidelberg.
Einzelne Panikattacken sind recht häufig und kommen bei 15 bis 30 % der Gesamtbevölkerung vor. Zur Panikstörung werden die Anfälle dann, wenn sie sich wiederholen, keinen Bezug zu einer Situation bzw. einem bestimmten Objekt haben und unvorhersehbar – also „aus heiterem Himmel“ – auftreten. Die Lebenszeitprävalenz der Panikstörung beträgt 3–5 % der Gesamtbevölkerung, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Bei jedem zweiten Patienten besteht begleitend eine Agoraphobie.
Die pathologische Panik hat ihren Ursprung in einer diffusen Angst des Patienten. Betroffene assoziieren körperliche oder seelische Veränderungen mit einer vermeintlichen Gefahr und reagieren darauf mit Sicherheits- und Vermeidungsverhalten gegenüber den scheinbar auslösenden Situationen. Der Teufelskreis nimmt seinen Lauf, am Ende kann schon die „Angst vor der Angst“ Symptome verursachen.
Wann stationär behandeln?
- drohende oder eingetretene Chronifizierung
- schwere Einschränkung der Alltagsbewältigung
- Gefährdung der Teilhabe am Erwerbsleben und/oder am gesellschaftlichen Leben
- unzureichende ambulante Therapie
- latente und akute Suizidalität
Gesundheitsfragebogen als Screeninginstrument
Haben Sie den Verdacht auf eine Panikstörung, führt meist schon eine sorgfältige und gründliche Anamnese zur Diagnose, so die Autoren. Eine Panikattacke geht definitionsgemäß mit intensivem Unbehagen und insgesamt vier Symptomen aus den vier Bereichen Vegetativum, Thorax/Abdomen, Psyche und allgemeine Beschwerden einher. Neben den Kriterien sollten psychosoziale Belastungsfaktoren in Familie, Beruf und Partnerschaft abgefragt werden. Als Screeninginstrument bietet sich der Gesundheitsfragebogen PHQ-D* an, den der Patient selbst ausfülllt. Mögliche körperliche Ursachen wie Arrhythmien, Hyperthyreose, Asthma und Migräne müssen Sie ausschließen. An obligaten Untersuchungen nennen die Kollegen:- Bestimmung von Elektrolyten, Entzündungsparametern und Schilddrüsenwerten
- Blutzuckermessung
- EKG mit Rhythmusstreifen
Beruhigt eingreifen
- Schaffen einer ruhigen, abgeschirmten Atmosphäre
- Psychoedukation: Mitteilung, dass die Attacke vorübergeht
- Aufmerksamkeit nach außen lenken (z.B. Patienten zum Lachen bringen)
- bleiben diese Maßnahmen erfolglos: ggf. Benzodiazepine (Cave: Suchtgefahr!)
Dreimal pro Woche 5 km joggen
Spontane Remissionen sind mit 10 % innerhalb von drei Jahren eher selten, psychische Komorbiditäten wie schwere Depressionen oder Alkoholmissbrauch häufig. Daher kommt der frühzeitigen Intervention unter Berücksichtigung der individuellen Präferenzen des Patienten eine erhebliche Bedeutung zu. Eine ambulant durchgeführte kognitive Verhaltenstherapie führt am ehesten zum Erfolg. Eine alleinige oder begleitende Pharmakotherapie kann ebenfalls erwogen werden. Zusätzlich profitieren Betroffene von regelmäßigem Ausdauersport, z.B. dreimal pro Woche 5 km joggen.Phytotherapeutika sind nicht zu empfehlen
SSRI und Venlafaxin gelten als Mittel der Wahl, bei fehlender Wirksamkeit oder Verträglichkeit ist Clomipramin indiziert. Der Einsatz von Benzodiazepinen beschränkt sich ausschließlich auf die Akuttherapie. Phytopharmaka aus Johanniskraut, Kava, Baldrian, Passionsblume etc. halten die Autoren u.a. aufgrund des teils schlechten Nutzen-Risiko-Verhältnisses für problematisch. Allerdings greifen viele Patienten schon vor dem Arztkontakt zu entsprechenden Präparaten. Fragen Sie deshalb gezielt danach und leisten Sie Aufklärungsarbeit!* Patient Health Questionnaire
Quelle: Kindermann D und Nikendei C. internist prax 2018; 58: 658-673