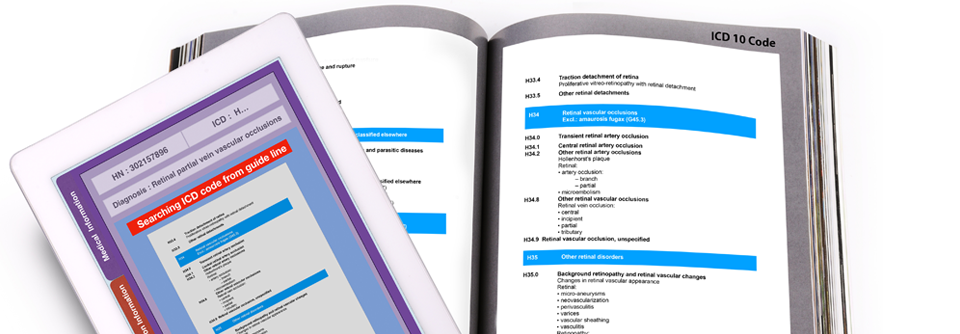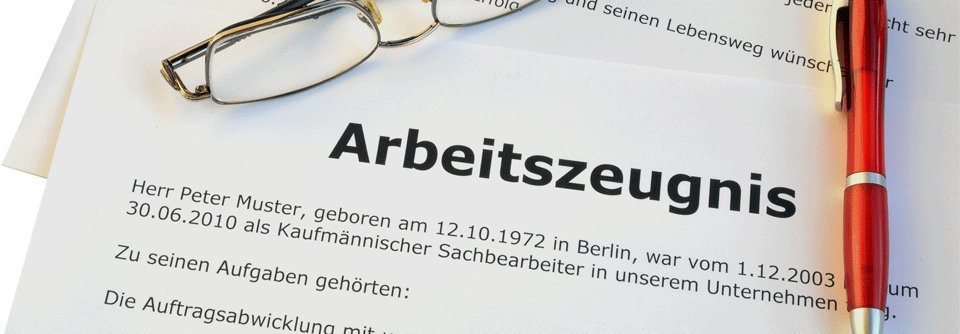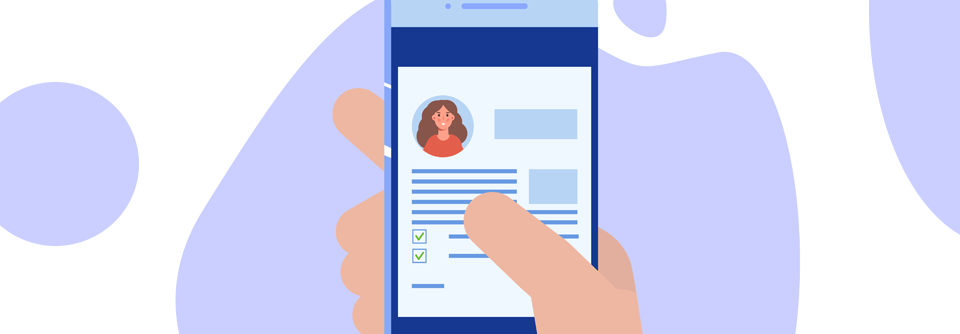
Patientenakte Nicht alles, was dokumentiert ist, gilt vor Gericht als erbracht
Ein Patient warf seiner Augenärztin vor, einen Netzhautriss übersehen zu haben, weil sie vor der Untersuchung keine Pupillenweitstellung veranlasst habe. Zudem sei sie durch ihren Sohn abgelenkt worden, der im Behandlungszimmer gespielt und ihr Bilder gezeigt habe.
Kläger war auf dem linken Auge erblindet
Die Medizinerin hatte dem Kläger mitgeteilt, bei seinen Beschwerden handele es sich lediglich um eine altersbedingte Erscheinung infolge einer Glaskörpertrübung. Er müsse sich keine Sorgen machen. Drei Monate später wurde eine Netzhautablösung festgestellt, es folgten eine OP und Komplikationen. Der Mann erblindete auf dem linken Auge.
Im EDV-System der Praxis fand sich der Eintrag „Pup in medikam. Mydriasis“. Da der Kläger nicht beweisen konnte, dass dies – wie er vermutete – nachträglich eingetragen wurde, scheiterte er vor Landes- und Oberlandesgericht.
Der Bundesgerichtshof stellte jedoch klar, der Patient müsse seit Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes 2013 keine entsprechenden Anhaltspunkte vorlegen – dies könne er im Regelfall auch gar nicht. Eine elektronische Dokumentation, die nachträgliche Änderungen nicht erkennbar mache, genüge den Anforderungen des § 360 Bürgerliches Gesetzbuch nicht. Nach diesen Bestimmungen seien Änderungen von Einträgen in der Patientenakte nur zulässig, wenn neben dem ursprünglichen Inhalt erkennbar bleibe, wann sie vorgenommen worden seien. Ziel sei eine fälschungssichere Dokumentation. Im Fall einer elektronisch geführten Patientenakte müsse die eingesetzte Software daher gewährleisten, dass nachträgliche Änderungen ersichtlich bleiben.
Die Richter verwiesen den Fall zur erneuten Verhandlung an das Berufungsgericht zurück.
Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs vom 27.04.2021, Az.: VI ZR 84/19