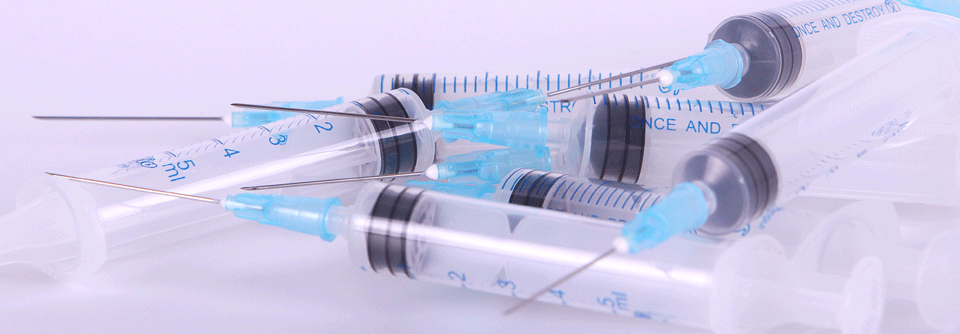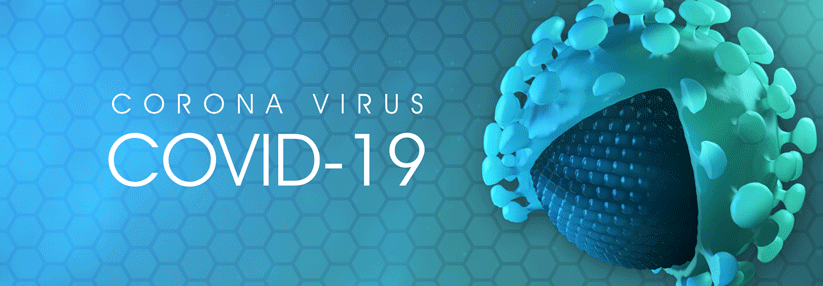
Coronavirus bringt Drogenabhängige in Gefahr
 Die Mitarbeiter im Eastside haben die Aktion #ZuhauseSchaffen gestartet.
© Verein Integrative Drogenhilfe (idh) e.V.
Die Mitarbeiter im Eastside haben die Aktion #ZuhauseSchaffen gestartet.
© Verein Integrative Drogenhilfe (idh) e.V.
Welche Veränderungen beobachten Sie in Ihrer Einrichtung?
Dr. Friers: Gerade am Anfang der Krise haben wir deutlich mehr Klienten aufgenommen. Unsere Schlafmöglichkeiten im Wohnbereich sind voll belegt und wir spüren deutlich, dass die Betroffenen durch die Situation unter noch mehr Druck stehen. Das kann sich z.B. in emotionalen Ausbrüchen oder inadäquatem Verhalten zeigen. Im Umkehrschluss erleben wir aber viel Unterstützung von ihnen.
Wie sieht es auf der Straße aus?
Dr. Friers: Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist die Lage der Klienten noch prekärer geworden. Gleichzeitig stellen wir dort eine Reduzierung der ambulanten und stationären Hilfsangebote der Drogenhilfe fest. All diese Faktoren führen zu einer erhöhten Gefährdung für drogenkonsumierende Menschen.
Was hat sich in der Einrichtung verändert?
Dr. Friers: Unseren Klienten ist allen sehr bewusst, dass eine Einrichtung wie das Eastside nicht schließen darf, denn dann verlieren sie ihr Zuhause. Wir beobachten, dass sie uns in hohem Maße unterstützen. Ein Beispiel: Wir haben die Hygienemaßnahmen gleich zu Beginn gesteigert, stündlich werden die Türklinken und Handläufe in unserem Haus desinfiziert. Das haben unsere Klienten übernommen. Und unsere Mitarbeiter haben unter #ZuhauseSchaffen auch eine kleine Aktion gestartet.
Wie sieht es mit der Versorgung der Drogenabhängigen aus?
Dr. Friers: Die Einkommensquellen für drogenkonsumierende Menschen wie Flaschensammeln oder Betteln gehen durch das Kontaktverbot deutlich zurück. Wir spüren deutlich, dass sich die Versorgungslage unserer Klienten verschlechtert hat. Vor diesem Hintergrund geben wir einmal täglich kostenlos ein warmes Essen aus. Das wurde insbesondere möglich durch Spenden der Bäckerei Eifler und Biogroßhandel Südwest Bio GmbH möglich. Aber auch Frankfurter Gastronomen unterstützen uns.
Wie wirkt sich das Virus auf den Drogenmarkt aus?
Dr. Friers: COVID-19 bewirkt, dass mit einem Engpass in der Versorgung mit illegalen psychoaktiven Substanzen zu rechnen ist. Die Drogenkonsumenten werden zunehmend schlechte oder gestreckte Drogen erhalten. Eine mögliche Folge kann sein, dass sie bedrohlich verlaufende und unbegleitete Entzugssituationen erleben werden. Da sie häufig verschiedene Substanzen (z.B. Benzodiazepine, Opioide und Alkohol) konsumieren, kann das zu lebensbedrohlichen Zuständen führen.
Wie lässt sich gegensteuern?
Dr. Friers: Es ist jetzt notwendig, für Opiatabhängige eine niedrigschwellige Substitution aufzubauen, auch für diejenigen, die in Deutschland nicht leistungsberechtigt sind. Was wir brauchen, ist eine lösungsorientierte Zusammenarbeit von Drogenhilfe, Ärzten, Ärztekammer, Kassenärztlicher Vereinigung und Gesundheitsbehörden.
Wurden bzw. werden die Klienten alle getestet?
Dr. Friers: Nein, sie werden nur im konkreten Verdachtsfall getestet.
Was passiert mit einem Infizierten, wie funktioniert eine Quarantäne?
Dr. Friers: Wir hatten im gesamten Bereich der Drogenhilfe keinen Fall einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus. Um aber für den Fall vorbereitet zu sein, haben die Stadt Frankfurt und verschiedene soziale Akteure mit Hochdruck an einer Einrichtung gearbeitet. Nur durch eine solche Einrichtung kann die Quarantäne sichergestellt werden und verhindert werden, dass erkrankte Menschen unterversorgt auf der Straße sind. Die Inbetriebnahme einer solchen Quarantäneeinrichtung steht kurz bevor.
Was heißt das für Sie konkret?
Dr. Friers: Für uns im Eastside ist das ein wichtiges Ergebnis. Aktuell sind 100 wohnungslose Drogengebrauchende hier untergebracht. Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern mit Gemeinschaftssanitäranlagen. Unter solchen Bedingungen ist eine Quarantäne oder Isolierung nicht möglich.
Wie lässt sich der Schutz für die Mitarbeiter gewährleisten?
Dr. Friers: Wir folgen den Empfehlungen SARS-CoV2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, den Vorgaben des Landes Hessen und der Stadt Frankfurt. Und natürlich den Empfehlungen des RKI.
Nachdem die Einrichtungen der Drogenhilfe in Hessen als systemrelevant anerkannt worden sind, werden sie auch in der Verteilung von Schutzausrüstung berücksichtigt. Wir haben aktuell sowohl FFP2-Masken, und Mund-Nasen-Schutz Masken erhalten. Auch Faceshields und Schutzbrillen stehen zur Verfügung. Die Integrative Drogenhilfe e.V. (idh) schafft fortlaufend ihrerseits Schutzkleidung für die Mitarbeiter an. Die FFP2-Masken werden vor allem für Situationen verwendet, an denen nah am Klienten gearbeitet wird, z. B. in Notfällen. Seit geraumer Zeit werden in den Einrichtungen der idh auch an Klienten Masken ausgeteilt.
Übrigens: im Eastside haben unsere Klienten in einem Sonderprojekt unter Anleitung der Sozialpädagogen selbst Masken genäht.
Wie klappt es in der Praxis?
Dr. Friers: Am Anfang war es herausfordernd, die Drogengebrauchenden immer wieder auf die Abstandsregelungen hinzuweisen. Wir mussten auch unseren Ablauf etwa im Café ändern, aber inzwischen sind die Regelungen eingeübt und die Klienten ermahnen sich gegenseitig.
Was die Hygienevorgaben betrifft, war die Herausforderung für uns nicht ganz so groß, weil es in der idh bereits geübte Praxis ist. Wir haben lediglich wie beschrieben die Desinfektionsmaßnahmen gesteigert. Unsere Mitarbeiter sind seit Jahren erfahren in der Anwendung der Hygieneregeln und in der Händedesinfektion, da regelmäßig unterschiedliche Projekte z.B. zu HIV und Hepatitis umgesetzt wurden. Auch unsere Klienten wurden hier bereits in den unterschiedlichen Gesundheitsprojekten und Gesundheitsgruppen „geschult“.
Vorübergehende Änderungen im Betäubungsmittelgesetz
Wie beurteilen Sie die Erleichterungen im BTM-Verordnungsprinzip?
Dr. Friers: Bei unserer Forderung der niedrigschwelligen Substitution gerade auch für nicht leistungsberechtigte Menschen zeigt sich eine Thematik immer wieder: der Engpass an suchtmedizinischen Ärzten. Auch vor diesem Hintergrund sind gerade die Änderungen der Vertretungsregelungen und der max. Patientenzahl positiv zu bewerten. Unter den Bedingungen von Abstandsregeln und Kontaktverbot spielen die erweiterten Take Home Regelungen wo vertretbar eine wichtige Rolle, um die Klienten, die zur Risikogruppe gehören zu schützen und flächendeckend und wohnortnah zu versorgen. Auch für pflegebedürftige und immobile Betroffene ist dies eine Erleichterung.Aus Sicht der idh kann dies aber nur ein erster Schritt sein. Was wir brauchen ist eine generelle Revision des Betäubungsmittelgesetzes, mit dem Ziel einer Entkriminalisierung des Drogenkonsums.
Was würden Sie sich generell von Hausärzten in der Betreuung Suchtkranker wünschen?
Dr. Friers: Wir brauchen ganz allgemein eine Verbesserung der medizinischen und auch pflegerischen Versorgung drogenkonsumierender Menschen. Zentral ist dabei auch die Haltung der Ärzte ihnen gegenüber. Es geht darum, die persönlichen Erfordernisse und Voraussetzungen der Drogengebraucher anzuerkennen und den Menschen nicht auf seine Suchterkrankung zu reduzieren, sondern vielmehr eine ganzheitliche Behandlung durchzuführen. Wir stellen immer wieder fest, dass unsere Klienten nicht adäquat untersucht werden, sondern sehr schnell eine Diagnose auf den Gebrauch der Drogen zurückgeführt wird. Hier wäre es sicherlich von Vorteil, wenn auch Allgemeinmediziner suchtmedizinische Kenntnis hätten.Eine engere Kooperation von Allgemeinmedizinern zu Fachmedizinern – etwa zu Gefäßchirurgen –, die der Behandlung von drogenkonsumierenden Menschen gegenüber offen sind, wäre ebenfalls von Vorteil.
Medical-Tribune-Interview