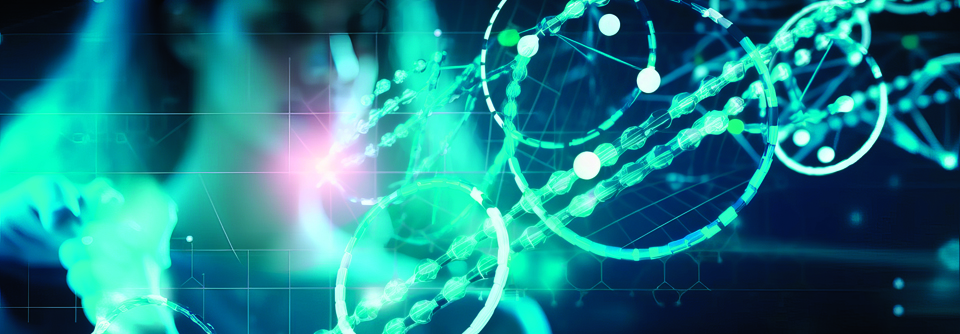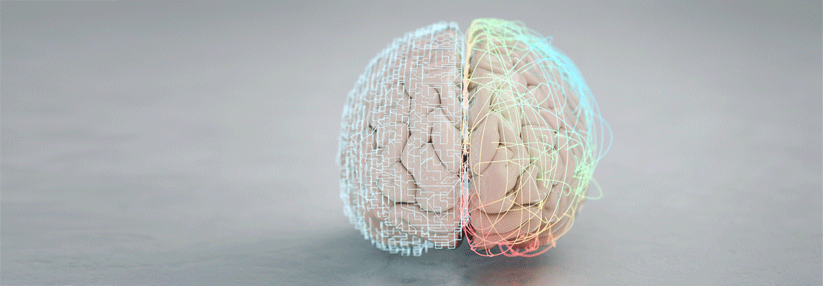
Diabetes und Depression Mehr als nur ein bisschen traurig
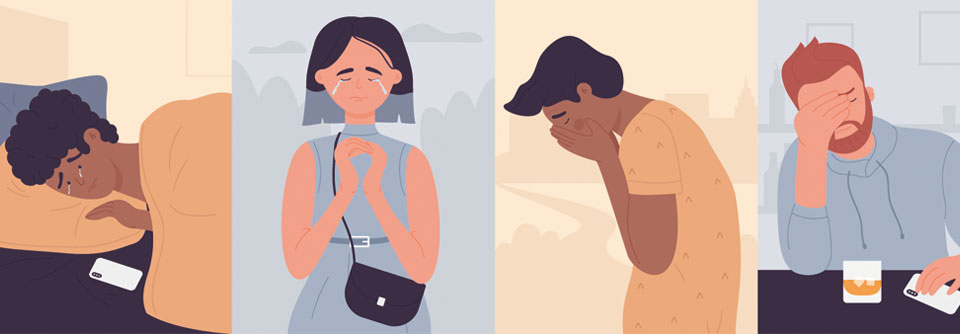 Körperliche Erkrankungen können auf die Psyche schlagen und psychische Erkrankungen erhöhen das Risiko für Diabetes.
© iStock/Flash vector
Körperliche Erkrankungen können auf die Psyche schlagen und psychische Erkrankungen erhöhen das Risiko für Diabetes.
© iStock/Flash vector
Depression ist nicht gleich Depression. „Der Begriff umfasst ein sehr heterogenes Störungsbild, das wir sehr beschreibend diagnostizieren“, so Prof. Dr. Martina de Zwaan, Direktorin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule Hannover. So umfasst der Begriff selbstlimitierende Zustandsbilder wie Trauer oder Anpassungsstörungen, Dysthymie bis hin zu schweren depressiven Episoden. Letztere gelten als systemische Störungen, die von körperlichen Erkrankungen beeinflusst werden, aber auch ihrerseits körperliche Krankheiten beeinflussen können, verdeutlichte die Expertin.
Chronische Erkrankungen gehen oft mit Depression einher
Die Prävalenz depressiver Störungen kann nicht nur bei Menschen mit Diabetes, sondern auch bei vielen anderen chronischen Erkrankungen erhöht sein. Studien zufolge liegt sie bei 12–18 % für Diabetes, 15–23 % für koronare Herzkrankheit, 20–50 % für chronische Nierenerkrankungen und 31–80 % für Multiple Sklerose – gegenüber 3–4 % in der Allgemeinbevölkerung.
Zudem liegen inzwischen neue Metaanalysen zur Prävalenz von Depression bei Menschen mit Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes vor. Bei einer dieser Analysen1 konnten 44 Studien berücksichtigt werden. Danach ist das Risiko bei Typ-1-Diabetes zweifach erhöht im Vergleich zu Kontrollen (22 % vs. 13 %). Ähnlich fielen die Ergebnisse bei Typ-2-Diabetes aus (19 % vs. 11 %). Eine Metaanalyse2 mit 109 Studien befasste sich eigens mit der Prävalenz von Depression und Angst bei Kindern. Demnach lag die Prävalenz bei Typ-1-Diabetes für Depression bei rund 22 % und für Angst bei knapp 18 %. Bei Kindern mit Typ-2-Diabetes fand sich eine Depressionsprävalenz von knapp 23 %, erklärte Prof. de Zwaan.
Zur umgekehrten Frage, wie häufig sich Diabetes bei Menschen mit psychischen Erkrankungen findet, bietet ein Umbrella-Review3 beachtenswerte Resultate. Demnach erwies sich die prozentuale Häufigkeit von Typ-2-Diabetes bei allen untersuchten psychischen Störungen als deutlich höher gegenüber der Allgemeinbevölkerung, u.a. bei bipolarer Störung (11 %), Depression (9 %), Angststörung (rund 14 %) und Binge-Eating-Störung (knapp 21 %). 245 Beobachtungsstudien aus 32 systematischen Reviews wurden dabei berücksichtigt.
„Doch was ist zuerst da?“, fragte Prof. de Zwaan, „das ist wahrscheinlich deutlich bidirektional“. Entsprechende Hinweise liefert ein zweites Umbrella-Review4, das 25 systematische Reviews umfasst.
Psychische Erkrankungen erhöhen das Diabetesrisiko
Demnach konnten psychische Störungen als Risikofaktoren für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes identifiziert werden: Bei Depression lag der RR-Wert zwischen 1,18 und 1,60, bei Schlafstörungen lag er bei 1,55–1,74 und bei Angststörungen bei 1,47, berichtete die Expertin. Noch einmal deutlich höher war der RR-Wert, wenn Behandlungen mit Antidepressiva (1,27–1,50) oder Antipsychotika (1,93–1,94) erfolgten.
Um den Zusammenhang zwischen Depression sowie anderen psychischen Störungen und Typ-2-Diabetes zu erhellen, stehen behaviorale und biologische Mechanismen im Fokus der Forschung (s. Kasten).
Auf Erklärungssuche
Warum entwickeln Menschen mit Depression und anderen psychischen Störungen gemäß Studienlage gehäuft einen Typ-2-Diabetes? Behaviorale und biologische Mechanismen – und auch deren Interaktion – gelten als potenzielle Erklärungen:
Behaviorale Mechanismen:
- ungesunder Ernährungsstil
- körperliche Inaktivität
- hoher Alkoholkonsum
- Rauchen
- Schlafstörung
- geringe Adhärenz bei Untersuchungen und Medikamenteneinnahme
Biologische Mechanismen:
- Gewichtszunahme und Adipositas
- erhöhte Aktivität an den Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achsen (HPA-Achsen)
- erhöhte Aktivität des Sympathikus
- Inflammation, erhöhte Zytokine
- erhöhte Insulinresistenz
- Dyslipidämie
- komorbide Erkrankungen
Dies ist insbesondere deshalb bedeutsam, da die Komorbidität von Diabetes und Depression mit einer signifikanten Zunahme der Gesamtmortalität verbunden ist. Letztere liegt höher als die Mortalität durch Diabetes oder Depression allein im Vergleich zu Menschen, die keine der beiden Erkankungen haben, erläuterte Prof. de Zwaan. Diese Resultate, die auf dem National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES-1) beruhen, konnten nun durch eine Taiwanesische Studie5 bestätigt werden.
Bei dieser Untersuchung zu Depression und Überlebensrate bei Menschen mit und ohne Diabetes wurden Patientendaten von 2000 bis 2015 berücksichtigt. Es zeigte sich: Sowohl Menschen, deren Depression noch vor ihrem Typ-2-Diabetes aufgetreten war, als auch Personen mit Depressionsbeginn nach der Diabetesdiagnose hatten eine erhöhte Mortalität im Vergleich zu Menschen mit Diabetes ohne Depression, verdeutlichte die Klinikdirektorin.
Screening auf Depression in Diabetestherapie verankern
Somit ist einerseits die hohe Komorbidität zwischen Depression und Diabetes zu beachten. Andererseits kommt erschwerend hinzu, dass Depressivität bei Menschen mit Diabetes mit einem ungünstigen Krankheitsverlauf und erhöhter Mortalität verbunden ist, resümierte Prof. de Zwaan. Über mögliche Ursachen dieser Zusammenhänge werde diskutiert: Maladaptives Krankheitsverhalten und psychophysiologische sowie neuroendokrinologische Veränderungen stehen dabei im Fokus (s. Kasten). Als praxisrelevante Empfehlung leitet sich daraus ab, auf die eine oder andere Weise auf Depression zu screenen und gegebenenfalls eine Behandlung zu empfehlen, so die Expertin. Zum Screening eigne sich aus praktischer Sicht zunächst z.B. ein kurzer 2-Item-Screening-Test oder auch der frei verfügbare Patient Health Questionnaire (PHQ-9). Die Säulen einer Behandlung seien Schulung, Maßnahmen der psychosomatischen Grundversorgung, gegebenenfalls eine Psychopharmakatherapie (cave: Gewichtszunahme) oder eine Psychotherapie.
1. Farooqi et al. Prim Care Diabetes 2022; 1: 1-10; DOI: 10.1016/j.pcd.2021.11.001
2. Akbarizadeh et al. World J Pediatr 2022; 18: 16-26; DOI: 10.1007/s12519-021-00485-2
3. Lindekilde et al. Diabetologia 2022; 65(3): 440-456; DOI: 10.1007/s00125-021-05609-x
4. Lindekilde et al. Diabetes Res Clin Pract 2021; 176: 108855; DOI: 10.1016/j.diabres.2021.108855
5. Huang et al. J Clin Psychiatry 2022; 83(1): 20m13692; DOI: 10.4088/jcp.20m13692
Quelle: Diabetes Update 2022