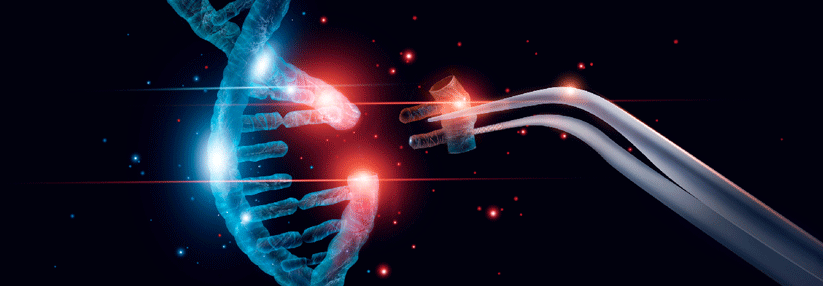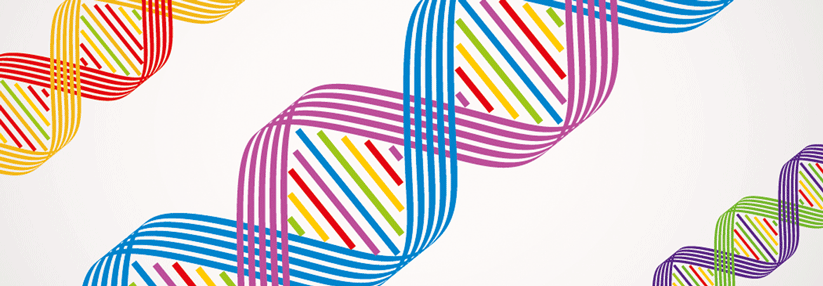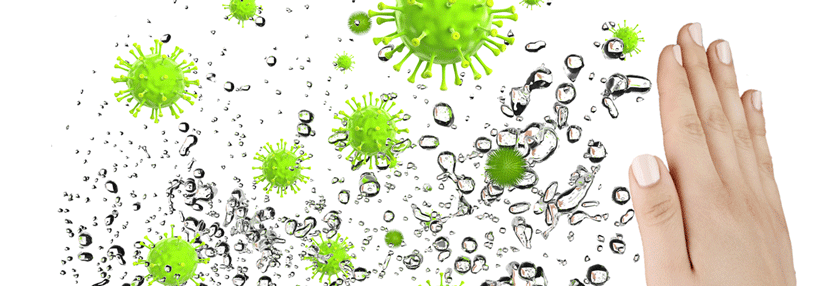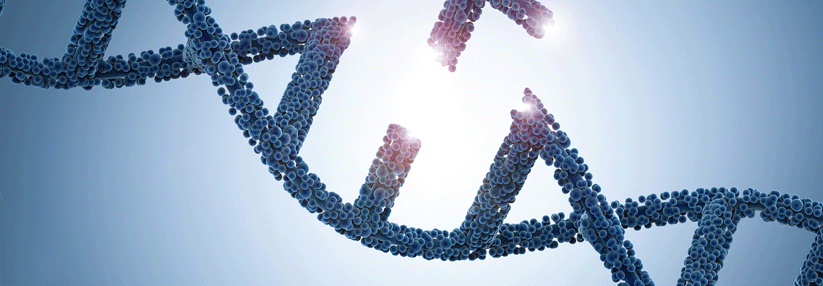Wie Epigenetik unser Verständnis von psychiatrischen Erkrankungen verbessert
 Unter anderem können negative Lebensereignisse bestimmte Risikogene aktivieren.
© Pixabay
Unter anderem können negative Lebensereignisse bestimmte Risikogene aktivieren.
© Pixabay
Es ist Samstag, 13:30 Uhr, kurz nach der Mittagspause, und der vorletzte Vortrag steht an. „Ich werde Ihnen heute ausschließlich tierexperimentelle Studien präsentieren“, begrüßt Professor Dr. Anna Katharina Braun von der Fakultät für Neurowissenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ihr Publikum. Starker Tobak also. Ein tiefes Seufzen geht durch die Reihen. Die Bedeutung für die tägliche Arbeit bringt die Kollegin jedoch direkt auf den Punkt: Frühe Traumatisierungen spielen eine essenzielle Rolle in der funktionellen Reifung des Gehirns – und damit für die Ätiologie psychiatrischer Erkrankungen.
Zeitpunkt der Erfahrungen entscheidet über Entwicklung
Vor allem ob Kinder ihre Erfahrungen vor oder nach dem sechsten Lebensjahr machen, sei laut der Expertin entscheidend für die weitere Hirnentwicklung. Denn dann stehen die Synapsen der Kinder miteinander im Wettbewerb. Erfahrungs- und aktivitätsgesteuert bauen sich die weniger genutzten Synapsen ab, während sich die Stammspieler unter ihnen verstärken. Beobachten kann man das am Beispiel neonataler Stressexposition bei Mäusen.
Wissenschaftler fanden heraus, dass sich ausschließlich bei weiblichen Jungtieren, die von ihrer Mutter schlecht gepflegt wurden, die DNA-Methylierung erhöhte. In deren Folge sank die Expression des neurotrophen Faktors BDNF* im medialen Präfrontalkortex. Traumatisierte Nager gaben außerdem mehr Stress- und Verlassenslaute von sich als Mäuse, die keine Misshandlung erfuhren. Prof. Braun erklärt die Beobachtung damit, dass frühkindliche Traumen eine Art zelluläres Gedächtnis formen, welches die weitere Entwicklung von neuronalen Netzwerken determiniert und damit in Verbindung mit neurodegenerativen bzw. psychiatrischen Erkrankungen stehen kann.
Negative Lebensereignisse aktivieren Risikogene
Als eine Art Dimmer, der die Funktion von Genen ein- oder ausknipst, sieht Professor Dr. Dr. Katharina Domschke von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg solche epigenetischen Mechanismen. Beispielsweise wirken biochemische Faktoren als Antwort auf negative Lebensereignisse unmittelbar an der DNA und entscheiden so, ob bestimmte Risikogene „wach sind oder schlafen“. Einmal aktiviert, kommt die genetische Vulnerabilität und damit die Störung zum Tragen.
Ein Grund zur Resignation? Nein, findet die Expertin. Laut aktuellen Arbeiten kann Psychotherapie z.B. bei Angsterkrankungen eine ungünstige Epigenese wieder ausgleichen. „Wenn man positiv auf die Therapie anspricht, normalisiert sich das Methylmuster. Gleiches gilt für pharmakologische Interventionen“, so Prof. Domschke. Ihrer Meinung nach stehen epigenetische Prozesse damit an der entscheidenden Schnittstelle zwischen Adaptation und Maladaptation, „also letztlich zwischen Resilienz und Risiko“.
Liegen prädisponierende Genvarianten vor, tragen prä- und perinatale Risikofaktoren wie mütterliches Rauchen oder ein niedriges Geburtsgewicht potenziell auch zur Entstehung von ADHS bei. Professor Dr. Paul Plener von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm nennt als Ursache die Interaktion mit 5-HTTLPR**. Im TRAIL-Survey zeigte sich, dass die ADHS-Symptomatik mit durchschnittlich 13,5 Jahren bei Kindern mit der homozygoten s-Allel-Variante von 5-HTTLPR die Anzahl personenzentrierter Stressoren zum 16. Lebensjahr voraussagt. Die Kombination dieses Genotyps und der ADHS-Ausprägung führt demnach zu größeren Verhaltensauffälligkeiten, die die Jugendlichen für interpersonelle Konflikte stärker prädisponiert.
Epigenetik hilft, Windows of Opportunity zu nutzen
Zusätzlich wiesen Heranwachsende mit dem low-activity-Monoaminooxidase-Genotyp plus einem geringen Geburtsgewicht deutlich mehr Symptome auf, vor allem in der frühen Adoleszenz. Das „Scharnier“ der Epigenetik wird für die Psychiatrie immer relevanter, ist sich Professor Dr. Dieter F. Braus, Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Helios Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken Wiesbaden, sicher. Befunde wie die dargestellten deuten an, dass man über die Prinzipien der Neuroplastizität vorhandene „Windows of Opportunity“ zielgerichteter nutzen und so die Vulnerabilität psychiatrischer Erkrankungen reduzieren kann (s. Kasten).
SSRI schützen vor Angstsymptomen
* Brain-derived neurotrophic factor
** Serotonin-Transporter-Polymorphismus
Quelle: 8. Psychiatrie-Update-Seminar