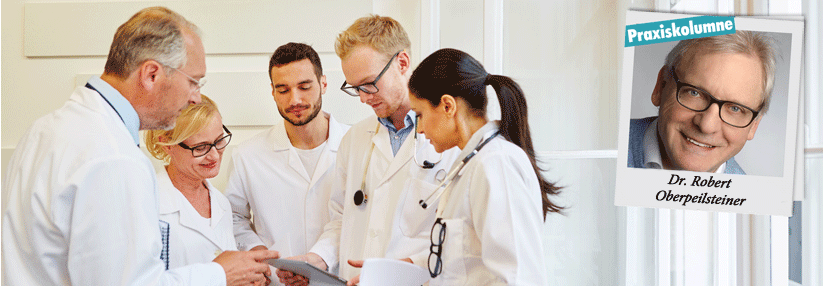Frust in Medizinstudium und Weiterbildung
 Viele Assistenzärzte leiden unter Burnout und Depressionen.
© fotolia/baranq
Viele Assistenzärzte leiden unter Burnout und Depressionen.
© fotolia/baranq
Die Zahl der Ärztinnen, Ärzte und Medizinstudierenden wächst beständig. Also müssten wir uns über unseren Nachwuchs keine Gedanken machen. Doch immer mehr Medizinstudierende und Assistenzärzte sind gefrustet, leiden an Burnout oder Depression. Aus Frankreich erreicht uns gar die Meldung einer erschreckenden Zahl von Suizidversuchen und Suiziden unter Medizinstudenten und Assistenzärzten. Was ist da los?
Das Projekt „Ich will Ärztin/Arzt werden“ fängt leider schon verkorkst an. Viele Abiturienten, vor allem Männer, müssen wegen des Numerus clausus bis zu 7,5 Jahre warten. Da ist fast jeder mehr als gefrustet und will möglichst schnell fertig werden. Doch dann droht neuer Ärger. So gibt es beispielsweise in der Vorklinik der Universität Mainz mehr Studierende als es die Lehrkapazität vorsieht. In der Folge müssen künftig eventuell Praktikums- und Seminarplätze ausgelost werden. Das wäre dann ein „innerer NC“, der die Studienzeit um ein oder zwei Semes-ter verlängern kann.
»In Frankreich haben fünf Assistenzärzte Suizid begangen«
Das letzte Wort scheint hier noch nicht gesprochen zu sein, haben doch die Studenten – Chapeau (!) – sofort eine Demo organisiert und die Politik zum Dialog in die Uni eingeladen. Minister und Ministerpräsidentin haben sich der Diskussion gestellt. Man kann nur hoffen, dass unser Nachwuchs diesen kämpferischen Geist im späteren Berufsleben beibehält.
Die Techniker Krankenkasse hat 2014 festgestellt, dass 10 % der Studentinnen und 5 % der Studenten wegen einer Depression behandelt wurden. Die Behandlung mit Antidepressiva hat seit 2006 um 43 % zugenommen. Die Verordnungen von Ritalin sind um das Vierfache gestiegen. Warum das so ist – darüber kann man nur spekulieren.
Ein Medizinstudent hat einmal gepostet: „Es ist nicht nur der Leistungsdruck, der uns krank macht, sondern es ist ein ständiger ,Begleiter‘, nämlich das zermürbende Gefühl, ununterbrochen einem Aussiebeverfahren zu unterliegen.“ Er beschrieb das auch als Ohnmacht, der „wir dauernd ausgesetzt sind“.
Mangelnde Zeit und Arbeitsdruck führen dazu, dass man sich nicht mehr untereinander austauscht. Wie wichtig das Sprechen über Probleme ist, lernt man zwar, aber in den eigenen Reihen findet es nicht statt. Was auch dazu führt, dass aus Frust Resignation wird.
So kann aber keine Gegenwehr entstehen. Diese wird nur aus längeren Diskussionsrunden heraus geboren. Ein Austausch in Foren entspricht nicht dem politischen Dialog unter Gleichgesinnten. In den Foren werden vornehmlich medizinische Fragen erörtert. Die gesundheitspolitische Diskussion findet oft nur marginal statt, müsste aber dringend forciert werden. Denn der schönste Beruf macht keinen Spaß mehr, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Und die hat nun mal die Politik zu verantworten.
»Aussieben erzeugt ein Gefühl der Ohnmacht«
Leider macht es dieses Desinteresse erst möglich, dass sich unsere Gesundheitspolitiker damit brüsten können, noch nie so leichtes Spiel mit den Ärzten gehabt zu haben wie in den letzten Jahren: Es konnte ohne Gegenwehr ein Gesetz nach dem anderen durchgewinkt werden. Vor dem Hintergrund, dass in Frankreich seit Anfang 2017 fünf junge Assistenzärzte Selbstmord begangen haben, hat die dortige Vereinigung der Medizinstudierenden und Assistenzärzte eine Befragung durchgeführt. Ergebnis: Jeder vierte Medizinstudent oder Arzt in Weiterbildung hat schon mindestens einmal daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. 738 von 22 000 Befragten gaben sogar an, bereits einen Suizidversuch unternommen zu haben. Mehr als jeder Vierte litt unter einer depressiven Symptomatik, die ansonsten nur bei 10 % der allgemeinen Bevölkerung auftritt.
Das jetzt mit einem „na ja, das ist in Frankreich passiert“ abzutun, wäre zu kurz gesprungen, kennen wir doch auch hierzulande die Zunahme der depressiven Erkrankungen bei Medizinstudierenden und Ärzten in Weiterbildung. Es scheint nur noch nichts Schlimmeres passiert zu sein.
In Deutschland kritisieren junge Ärzte, sie hätten immer weniger Zeit für die Patienten, vor allem für das Gespräch. Der Grund seien mehr organisatorische Aufgaben, eine den DRGs geschuldete, kürzer werdende Verweildauer der Patienten, die Ökonomisierung und die mangelnde Wertschätzung durch die Vorgesetzten.
Eine Crux scheint auch der Umstand zu sein, dass angehende Allgemeinärzte in Rotationsstellen die Abteilungen nach sechs bis zwölf Monaten wieder verlassen, zu einem Zeitpunkt, an dem sie gerade einigermaßen eingearbeitet sind. Manchem Weiterbilder/Vorgesetzten im Krankenhaus gefällt diese Situation nicht, bedeutet der dauernde Wechsel doch Stress und Mehrarbeit und nur selten Entlastung. Es entsteht eine spannungsgeladene Situation, unter der dann wieder die Weiterbildungsassistenten zu leiden haben.
Doch wir wissen alle, wie wichtig es ist, Fachärzte für Allgemeinmedizin weiterzubilden. Sie sind der Dreh- und Angelpunkt der ambulanten Versorgung. Und auch für ein Krankenhaus ist der Benefit groß, wenn mit den gut weitergebildeten Allgemeinmedizinern in den umliegenden Praxen eine jahrelange gute Zusammenarbeit möglich wird.