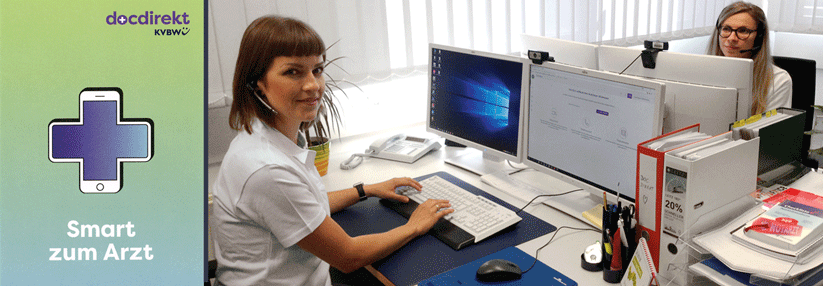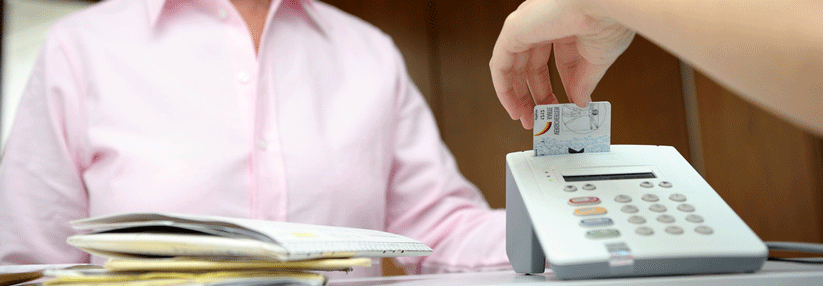Teledoktoren sollen im Ländle bleiben – Was Deutschland beim Thema Telemedizin noch lernen kann
 Telemedizinische Angebote im europäischen Ausland funktionieren. Deutschland hinkt hinterher. (rechts oben: Professor Dr. Alexander P. F. Ehlers, Rechtsanwalt und Arzt; rechts unten: Dr. Ulrich Clever, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg)
© Stock/verbaska_studio; privat; LÄK Baden-Württemberg
Telemedizinische Angebote im europäischen Ausland funktionieren. Deutschland hinkt hinterher. (rechts oben: Professor Dr. Alexander P. F. Ehlers, Rechtsanwalt und Arzt; rechts unten: Dr. Ulrich Clever, Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg)
© Stock/verbaska_studio; privat; LÄK Baden-Württemberg
Nachdem die Landesärztekammer Baden-Württemberg 2016 ihre Berufsordnung für rein telemedizinische Projekte ohne jeglichen direkten Arzt-Patienten-Kontakt geöffnet hat, warten Beobachter nun auf den Start genehmigter Modellprojekte. Ein erstes „Go“ könnte der Kammervorstand im Oktober aussprechen. Das berichtete Ärztekammerpräsident Dr. Ulrich Clever bei der Tagung „Digital Health“ in München.
Details verriet er nicht, das seien „Business cases“. Nur so viel: Das bereits publik gemachte Projekt der KV Baden-Württemberg, bei dem ein Patient mit einem Callcenter die Dringlichkeit seines Gesundheitsproblems abklärt und bei Bedarf noch am selben Tag einen Termin in einer Praxis angeboten bekommt, wird zwar zu den ersten Modellen gehören, ist aber nicht das aktuelle. Die Anzahl der Projekte, die von der Kammer derzeit geprüft werden, gab Dr. Clever mit den ausgestreckten Fingern einer Hand an. Man achte genau auf die Einhaltung der Berufsordnung, es dürfe bei der Fernbehandlung „kein Wildwest“ geben.
Im Telemedizintarif preiswerter versichert
Dass sich Patienten per Telefon gut steuern lassen, kann Angelo Eggli, Geschäftsführer der Medi24 AG in Bern, belegen. Das Schweizer Unternehmen mit dem Status einer Arztpraxis bietet seit 1999 Tele-Konsultationen an. Seine Kunden sind Krankenversicherer. Die wiederum bieten ihren Versicherten Prämienermäßigungen an, wenn diese sich vertraglich binden, bei Gesundheitsbeschwerden zunächst Medi24 zu konsultieren.
In diesem Jahr erbrachte das Unternehmen bislang 350 000 Beratungen in vier Sprachen. Ein Ziel ist es, die Zahl der „Real- und Notfallkonsultationen“ von Ärzten zu reduzieren, um Kosten zu vermeiden. Dazu nutzen die 20 Ärzte und 70 Pflegefachleute des Unternehmens bei der telefonischen Beratung eine Triagesoftware, mit deren Hilfe sie den Patienten die relevanten Fragen stellen und nichts dabei vergessen.
Am Ende erhält der Patient eine Information zur Dringlichkeit seiner Behandlung. Das reicht von Anleitungen zur Selbstbehandlung über ein Rezept bis zur Vermittlung von Leistungserbringern, bei denen sich der Patient vorstellen soll. „Wir kombinieren Mensch und Maschine“, fasst Eggli das Angebot zusammen.
Nur 8 % müssen wirklich sofort zum Arzt
Das Callcenter nutzt eine medizinische Wissensdatenbank in Laiensprache – und hat Google-Verbot bei der Suche nach medizinischen Informationen. Bei 92 % der Anrufe müssten die „Ärzte im Backoffice“ nicht einbezogen werden. Ein Telefonat dauere im Schnitt sieben Minuten. Zunehmend schickten Patienten auch Fotos über einen gesicherten Pfad zur Begutachtung ein.
62 % der Anrufer würden eine abschließende medizinische Antwort zur Selbstbehandlung erhalten, sodass sie keinen Arzt in Anspruch zu nehmen bräuchten, sagt Eggli. Obwohl viele Kunden mit der Intension anriefen, als Notfall behandelt zu werden, müsste nur bei 8 % der Fälle einem Anrufer das sofortige Aufsuchen eines Haus- oder Notarztes bzw. Krankenhauses empfohlen werden. Einen „Gerichtsfall wegen falscher Beratung“ habe es bis dato nicht gegeben, betont Eggli.
Antwort kommt umgehend, die Arznei am nächsten Tag
Ein anderes Modell einer rein telemedizinischen Versorgung betreibt das Start-up-Unternehmen „DrEd“ von England aus. Hier müssen die Kunden für die ärztliche Beratung und Behandlung (Rezept) selbst aufkommen (Preis: 9 bis 49 Euro); die Arzneimittelkosten werden ggf. von Krankenversicherungen erstattet.
Die Kunden nehmen den Kontakt über die Homepage auf. Sie füllen einen medizinischen Fragenbogen aus. Die Daten gehen in eine elektronische Patientenakte ein und sind die Grundlage der Behandlung. „Wir ermöglichen einen barrierefreien Zugang zum Arzt“, sagt David Meinertz, Gründer und Geschäftsführer von DrEd. Innerhalb einer Stunde erhalte der Patient eine Antwort. Für deutsche Patienten wird ein Rezept an eine Versandapotheke weitergeleitet, die das Medikament bis zum nächsten Werktag zustellt. In England, wo es das elektronische Rezept längst gibt, geht dieses an die gewünschte Apotheke. Für französische Patienten wird ein Papier- rezept an die Apotheke gefaxt. DrEd ist zudem in Irland, Österreich und der Schweiz aktiv. England sei der größte Markt, der deutsche wachse am schnellsten, sagt Meinertz.
Seit dem Start des Unternehmens im Jahr 2011 wurden 1,5 Mio. Patienten aus der Ferne beraten. Im August waren es 70 000, davon 15 000 aus Deutschland. Meinertz hofft, dass sich die Zahl der monatlichen Anfragen in den nächsten Jahren verfünffachen wird.
Richtige Adresse bei Erektionsstörungen
Dabei konzentrieren sich die rund 100 Mitarbeiter, davon 16 Ärzte, auf 50 Erkrankungen, die sich telemedizinisch gut behandeln lassen. Menschen mit unbestimmten Schmerzen im Bauch oder einem Taubheitsgefühl in Extremitäten „sind nicht unsere Patienten“, sagt Meinertz. Sie werden aufgefordert, einen Arzt vor Ort aufzusuchen. Auf der Homepage sieht man, dass „beliebte Sprechstunden“ Erektionsstörungen, vorzeitigen Samenerguss, Haarausfall, Verhütung, Asthma, Blasenentzündung, Chlamydien, Bluthochdruck und Malariaprophylaxe zum Inhalt haben.
Kein Interesse an einer Videosprechstunde
Bei solchen „einfachen medizinischen Problemen“ akzeptieren die Patienten eine asynchrone Kommunikation (Fragebogen, E-Mails), erklärt Meinertz. Und bei großen medizinischen Problemen sei das persönliche Gespräch mit einem Arzt nötig. Darum sei auch das Angebot einer Videosprechstunde nicht angenommen und von DrEd wieder gestrichen worden: „Die Patienten fragen nicht nach.“
Ärztekammerchef Dr. Clever wiederum würde es lieber sehen, wenn solche telemedizinischen Angebote wie in der benachbarten Schweiz und in England künftig „im Land“ bleiben. Darum die Modellprojekte.
Der Münchner Rechtsanwalt und Arzt Professor Dr. Dr. Alexander P. F. Ehlers ist davon überzeugt, dass die nächste Bundesregierung der Digitalisierung große Aufmerksamkeit widmen wird – „ich prophezeie eine Liberalisierung“. Es lägen enorme Chancen in der Telemedizin und „Smart Data“, um die Versorgung effizienter und besser zu machen. In Deutschland werde viel über Risiken, insbesondere beim Datenschutz, gesprochen. „Wir müssen offener denken“, meint der Jurist und Politikberater. Der Aachener Klinikdirektor und Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Telemedizin, Professor Dr. Gernot Marx, geht davon aus: „In den nächsten zehn Jahren ändert sich die Medizin mehr als in den letzten 100 Jahren.“ Personalisierte Medizin, künstliche Intelligenz/Big Data, Robotik, Telemedizin – große Dinge deuten sich an. Allerdings müssten sie nicht nur technisch machbar sein, sondern von Anwendern wie Betroffenen auch akzeptiert werden, wofür es eines nachweisbaren Nutzens bedürfe.
Und einen vollständigen Schutz vor Datendieben gebe es nicht. Das sei eBanking-Kunden offensichtlich klar, sie würden trotz bekannter Risiken an dem Angebot festhalten. „So sollten wir es im Medizinbereich auch halten“, rät Prof. Marx.
Bedenkenträger und Besitzstandswahrer
Dass Telematik und Telemedizin in Deutschland bislang mühselig vorangekommen sind, führten etliche Redner bei der Digital-Health-Tagung vor allem auf die Selbstverwaltung zurück, deren Interessenvertreter sich immer wieder als Bremser und Besitzstandswahrer betätigt hätten. Auch die IT-Industrie bekam wegen Barrieren bei der Praxissoftware und der Verzögerung bei den Telematik-Komponenten ihr Fett weg.
Quelle: „Digital Health“ – Kongress der Süddeutschen Zeitung