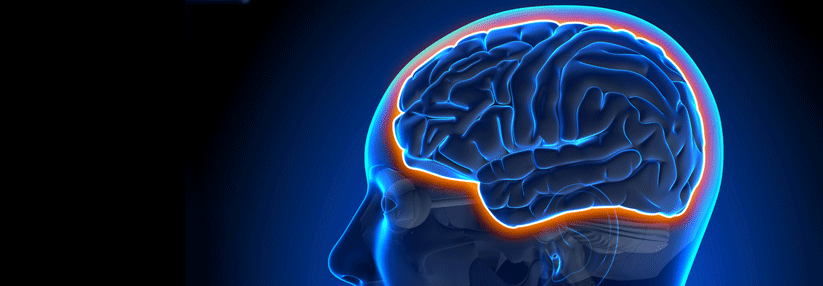Suizid: Absicht durch aufmerksamen Umgang mit Patienten erkennen
Alle 56 Minuten nimmt sich eine Person in Deutschland das Leben. Gesprochen wird darüber meist nicht. Dabei sterben jedes Jahr mehr Menschen durch einen Suizid, als an Verkehrsunfällen, Drogenmissbrauch und HIV-Infektionen zusammen, betonen die Psychologin Dr. Bianca Senf von der Abteilung für Psychoonkologie am Universitätsklinikum Frankfurt und ihre Kollegen. Etwa jeder siebte onkologische Patient hegt suizidale Gedanken. Und auch wenn viele Ärzte nicht daran glauben: Die eigenen Patienten können dazugehören.
Es mag paradox klingen: Aus Angst, vielleicht an Krebs zu sterben, tötet man sich selbst? Ein Widerspruch sei dies nicht, so die Experten. Aussagen wie „Was soll das alles noch?“, „Ich will nicht ständig ins Krankenhaus, mich wegen der Chemo erbrechen, unter Schmerzen leiden“ oder „Ich kann nicht mehr“ kommen bei Krebspatienten häufig vor. Aus einer Befragung von 87 onkologisch tätigen Ärzten geht hervor, dass fast zwei Drittel solche Sätze mindestens einmal im Jahr hören. Ähnlich hoch ist der Anteil der Kollegen, die von einem tatsächlichen Suizid eines ihrer Patienten erfahren.
Könnten Suizide vermieden werden? Retrospektiven Analysen zufolge wenden sich Menschen mit suizidalen Gedanken oder Absichten an ihren Arzt. Und sie kündigen in den meisten Fällen an, dass sie sich das Leben nehmen möchten – wenn auch nicht immer direkt. Fast 95 % von ihnen liefert mehr oder weniger deutliche Hinweise. Daher plädieren die Autoren an Ärzte, entsprechende Aussagen ihrer Patienten wirklich ernst zu nehmen. Diese sollten offen angesprochen und thematisiert werden (Tipps dazu im Kasten). Eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation kann vor einer tatsächlichen Selbsttötung schützen, zeigen Studien.
Wir müssen reden
- Wie stark fühlen Sie sich seelisch belastet?
Die Bewertung kann z.B. auf einer Skala von null bis zehn erfolgen. Dabei steht null für „überhaupt nicht belastet“ und zehn für „maximal belastet“. - Wie schätzen Sie selbst Ihre Situation ein? Denken Sie, dass sie aussichtslos ist?
- Gibt es jemanden, mit dem Sie über Ihre Sorgen sprechen können?
- Haben Sie noch Interesse an Ihrem Beruf, Ihren Hobbys? Treffen Sie sich mit Freunden? Oder fehlt Ihnen dazu alle Energie?
Quälende Atemnot beim Lungenkrebs als Trigger
Auch trägt die Art des Tumors – und eng damit verbunden die Prognose – zu Suizidgedanken bei. Vor allem Bronchialkarzinome lassen die Raten nach oben schnellen. Vermutlich, weil sie meist schnell wachsen und zu einer als besonders quälend erlebten Atemnot führen. Mamma- und Prostatakarzinome liegen auf dem zweiten bzw. dritten Platz der Gefährdungsskala. Ein wesentliches Risiko besteht zudem für Patienten mit Pankreaskarzinom. Der Tumor ist zum Zeitpunkt der Diagnose meist schon so weit fortgeschritten, dass eine Heilung sehr unwahrscheinlich ist – und das wissen die Betroffenen.Nach der Diagnose und nach der Therapie wird’s kritisch
In der ersten Woche nach der Diagnose besteht eine besonders hohe Suizidgefahr, erklären die Psychologen. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung liegt sie fast 13-mal höher. Ein weiterer kritischer Zeitraum liegt nach Abschluss der Behandlung. Eine Therapie gibt den Patienten eine Struktur. Erst danach werden viele mit den Beeinträchtigungen der Behandlung konfrontiert. Wie aber soll man sich verhalten, wenn einem der eigene Patient als gefährdet erscheint? Die Autoren raten dazu, sich dieser Aufgabe nicht allein zu stellen, wenn man sich ihr nicht gewachsen fühlt. Erfahrene Psychiater, Psychoonkologen oder der sozialpsychiatrischen Dienst bieten Hilfe. Die Praxis zeigt, dass es die meisten Patienten mit suizidaler Absicht als erleichternd empfinden, aktiv darauf angesprochen zu werden. Mit einem verständnisvollen, offenen und wertfreien Gespräch kann der erlebten Ausweglosigkeit entgegengewirkt werden. Über alledem dürfe die eigene Absicherung nicht vergessen werden, schließen die Autoren. Die Gespräche sollten genau in den Patientenakten dokumentiert werden, mit Details zum Inhalt des Gesagten und den ergriffenen Maßnahmen.Quelle: Senf B et al. Hess Ärztebl 2020; 4: 240-245