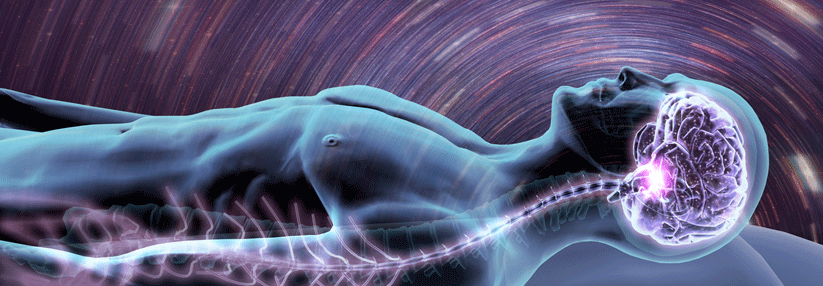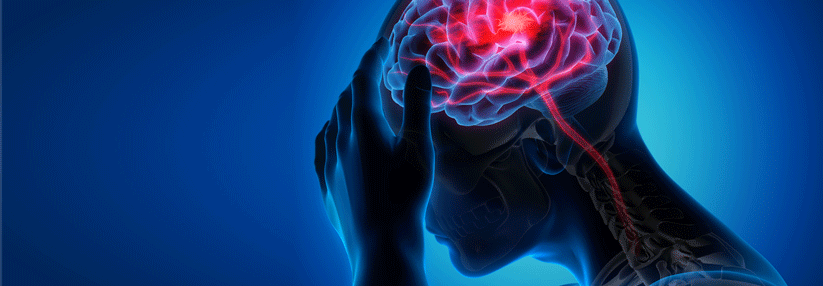
Wie eine gestörte Nachtruhe das Schlaganfallrisiko beeinflusst
 Schlag auf Schlaf: Wer schlecht schläft, scheint anfälliger für Insulte zu sein. (Agenturfoto)
© amenic181 – stock.adobe.com
Schlag auf Schlaf: Wer schlecht schläft, scheint anfälliger für Insulte zu sein. (Agenturfoto)
© amenic181 – stock.adobe.com
Dem Zusammenhang von gestörtem Schlaf und Schlaganfall hat sich eine Gruppe von Experten aus vier großen Fachgesellschaften (European Academy of Neurology EAN, European Respiratory Society ERS, European Sleep Research Society ESRS, European Stroke Organization ESO) angenommen und die Literatur zum Thema seit 1990 gesichtet.
Dabei prüften sie für jede Entität Daten zur Phase vor und nach dem Schlaganfall: Erhöht die jeweilige Schlafstörung das Schlaganfallrisiko, und sinkt es, wenn die Störung erfolgreich behandelt ist? Tritt die Störung nach einem Schlaganfall gehäuft auf? Beeinflusst sie Outcome und Sterberisiko und wie wirkt sich die Therapie der Schlafstörung aus?
Schlafbezogene Atemstörungen
Dass die unbehandelte schwere obstruktive Schlafapnoe (OSA) das Schlaganfallrisiko in etwa verdoppelt, stützt sich auf solide Evidenz. Es scheint, dass Patienten im jungen bis mittleren Lebensalter durch OSA besonders gefährdet sind. Dies könnte daran liegen, dass andere altersassoziierte Risikofaktoren bei ihnen noch wenig ins Gewicht fallen. Zwischen Frauen und Männern scheint kein relevanter Unterschied zu bestehen.
Gesondert analysiert wurden Studien an Patienten mit KHK oder Vorhofflimmern. Die Datenlage ist zwar noch etwas dünn, suggeriert aber ebenfalls ein Zusatzrisiko durch die OSA. Für ältere Patienten gilt dies möglicherweise nicht.
Widersprüchlich erscheinen die Ergebnisse zu Therapieeffekten. Beobachtungsstudien zufolge könnte die Überdruckbeatmung per CPAP-Maske risikomindernd wirken, in Metaanalysen randomisierter klinischer Studien (RCT) ließ sich dies allerdings nicht bestätigen.
Man sollte genauer untersuchen, ob eine gute CPAP-Adhärenz mit einer Masken-Tragezeit von mehr als vier Stunden pro Nacht zur Risikoreduktion beitragen kann, fordern die Autoren. Das gelte besonders für Patienten mit schwerer OSA und ausgeprägter Tagesmüdigkeit. Zum Effekt anderer OSA-Therapieoptionen, etwa Unterkiefer-Protrusionsschienen, auf das Schlaganfallrisiko gibt es kaum Studien, auch hier besteht also Nachholbedarf.
Nach dem zerebrovaskulären Ereignis leiden Patienten häufig an schlafbezogenen Atmungsstörungen. Um sie zu diagnostizieren, braucht es kein Schlaflabor. Tragbare Polygraphiegeräte reichen aus. Eine schwere obstruktive Schlafapnoe verschlechtert das neurologische Outcome von Schlaganfallpatienten, reduziert ihre Lebenserwartung und erhöht das Rezidivrisiko. Die CPAP kann die neurologische Erholung fördern, lindert Schläfrigkeit sowie depressive Symptome. Es lohnt sich daher, diese Therapie zu versuchen. Einmal akzeptiert, scheint sie mit einer guten Compliance einherzugehen.
Insomnie
Ein- und Durchschlafstörungen sind als Risikofaktor kardiovaskulärer Erkrankungen etabliert, vor allem wenn die Schlafdauer objektiv verkürzt ist. In Bezug auf das Schlaganfallrisiko sind die Studienresultate gemischt, der Zusammenhang ist nicht belegt. Dies mag zum einen an uneinheitlichen diagnostischen Kriterien für Insomnie liegen, zum anderen an Begleiterkrankungen, die als Confounder wirken.
Ob eine Behandlung der Schlaflosigkeit das Schlaganfallrisiko senken kann, wurde kaum untersucht. Es gibt jedoch gute Hinweise, dass die chronische Anwendung von Benzodiazepinen oder Z-Substanzen kognitive Störungen, Demenz und Mortalität begünstigt. Hoch dosiert und in Langzeitanwendung könnten Benzodiazepine Schlaganfälle fördern.
Ein Studien-Bias ist jedoch nicht auszuschließen, schließlich leiden Patienten in schlechtem Gesundheits- oder neurologischem Zustand häufiger an Schlafstörungen und erhalten deshalb wahrscheinlich häufiger Benzos.
Nach einem Schlaganfall klagen vor allem Frauen gehäuft über Schlaflosigkeit, oft kombiniert mit Depressionen. Was sich wirksam dagegen tun lässt, ist unklar. Hypnotika können den Schlaf fördern, besagt eine qualitativ nicht sehr hoch angesiedelte Studie. Es gibt aber Berichte, dass sie die neurologischen Defizite eher noch verstärken.
Placebokontrollierte Studien an Postschlaganfall-Patienten mit Insomnie wären wünschenswert und vor allem Studien zu nicht-medikamentösen Möglichkeiten der Schlafförderung, da die meisten psychotropen Arzneimittel mit einer erhöhten Mortalität in Verbindung gebracht werden.
Restless-Legs-Syndrom (RLS) und periodische Beinbewegungen (PLMS)
Bei Restless-Legs-Syndrom (RLS) und periodischen Beinbewegungen (PLMS) erscheint ein Zusammenhang mit dem Schlaganfallrisiko plausibel, gehen doch beide mit einer Hyperaktivität von Sympathikus und Hypothalamus-Hypophysen-Achse sowie inflammatorischen Kaskaden einher.
Die aktuell verfügbare Evidenz ist für die RLS allerdings dürftig. Die Studien sind inkonsistent und widersprüchlich. PLMS könnten tatsächlich ein unabhängiger Risikofaktor sein. Jedenfalls kam eine Metaanalyse von fünf Studien, in denen Confounder sorgfältig geprüft wurden, zu einer etwa 25%igen Risikoerhöhung in acht Jahren. Studien zum Einfluss der RLS- bzw. PMLS-Therapie auf das Schlaganfallrisiko fehlen ganz.
Plausibel wäre auch eine erhöhte Inzidenz von RLS und PLMS nach dem Schlaganfall, aber auch hier krankt die Datenlage an Inkonsistenz. PLMS scheinen nach einem Schlaganfall schwerere Ausprägungen anzunehmen. Therapiestudien: keine.
Zusammenfassend lässt sich also konstatieren: viele offene Fragen, wenig Evidenz. Das ergibt eine lange To-do-Liste für die Schlafforscher.
Quelle: Bassetti CLA et al. Eur Respir J 2020; 55: DOI: 10.1183/13993003.01104-2019