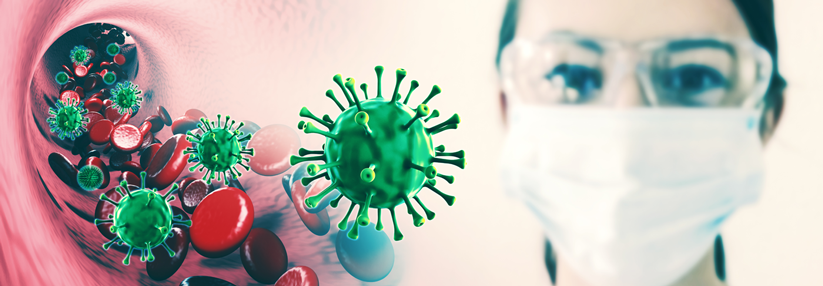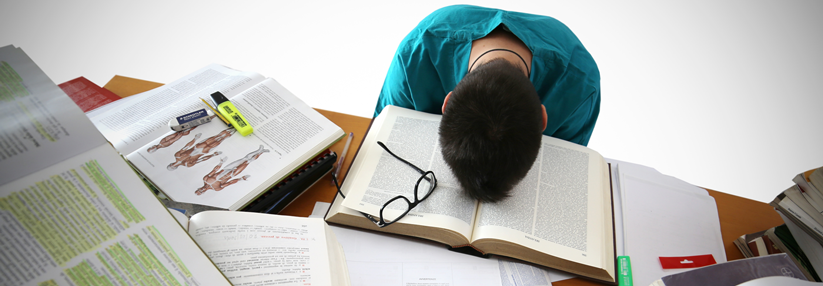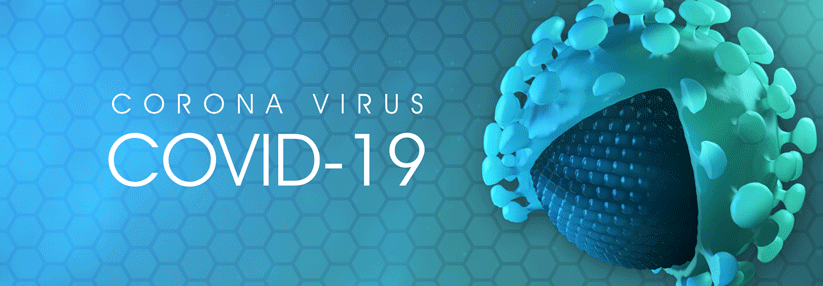
Corona-Front: Bundesländer wollen „Versorgungsärzte“ zum Einsatz verpflichten
 Der Versorgungsarzt und sein Arbeitsstab werden zu Krisenmanagern gemacht.
© NicoElNino – stock.adobe.com
Der Versorgungsarzt und sein Arbeitsstab werden zu Krisenmanagern gemacht.
© NicoElNino – stock.adobe.com
Eigentlich liegt der Sicherstellungsauftrag für die ambulante ärztliche Versorgung bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Dieser wird jetzt jedoch durch Landesgesetzgebung in Bayern und Nordrhein-Westfalen teilweise ausgehebelt, wenn es um die Versorgung im Rahmen der Corona-Krise geht. In der Ärzteschaft kommen die Aktivitäten gar nicht gut an. Sie werden als Ausdruck des Misstrauens gewertet.
Und so sehen die Regelungen aus: Seit Verkünden des „Notfallplans Corona-Pandemie“ am 26. März kann die ärztliche Versorgung in Bayern regional durch Landräte und Oberbürgermeister sichergestellt werden – mithilfe eines „Koordinators für die ambulante ärztliche Versorgung“, dem sog. Versorgungsarzt. Infrage kommen für diese Aufgabe ausschließlich Fachärzte mit langjähriger beruflicher, insbesondere vertragsärztlicher Erfahrung.
Versorgungsärzte unterstehen den Bürgermeistern
Dem Versorgungsarzt wird ein Arbeitsstab zugeordnet, für den die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) sowie die ärztlichen Kreis- und Bezirksverbände auf Anforderung des Versorgungsarztes ausreichend geeignetes Personal bereitzustellen haben.
Der Vorstand der KVB bewertet diese Regelungen in einer Pressemitteilung als grundsätzlich sinnvoll, denn „die Verantwortung für die Umsetzung liegt nun bei den Landräten und Oberbürgermeistern und den von diesen zu benennenden Versorgungsärzten“. Die Zwangsrekrutierung stößt jedoch auch beim dreiköpfigen KV-Vorstand auf Unverständnis. Dies sei „ein unnötiger Ausdruck des Misstrauens gegenüber der hoch leistungsfähigen und -willigen Ärzteschaft“. Sehr viele Ärzte hätten sich bereits freiwillig für Abstriche und telefonische Beratung gemeldet.
Freistaat wird übergriffig, Politik mit der Brechstange
Landrat Heinrich Trapp hat für Landau an der Isar den Allgemeinmediziner Dr. Lothar Wittek, Mitinhaber einer Hausarztpraxis in Dingolfing und ehemaliger KV-Vorsitzender in Bayern, zum Versorgungsarzt ernannt. Gegenüber Medical Tribune erklärte Dr. Wittek: „Diese Aufgabe habe ich übernommen, weil ich überzeugt bin, dass mich alle Ärzte vor Ort unterstützen und mit ihrer Arbeit dazu beitragen werden, dass die Versorgung auch in diesem Katastrophenfall gesichert ist, wenn es gelingt, für die notwendige Schutzausrüstung zu sorgen.“
Es werde von niemandem bestritten, dass die Vertragsärzte in der Versorgung der Corona-Patienten sehr aktiv seien und schon viel geleistet hätten, so Dr. Wittek. Das Problem sei die sehr begrenzte Schutzausrüstung und die begrenzten Desinfektionsmittel. Ziel sei es deshalb, COVID-19-Patienten in Schwerpunktpraxen zu behandeln, in der Erwartung, dass dafür die Schutzausrüstung ausreicht. „Diese Schwerpunktpraxis ist einzurichten und mit dem notwendigen Personal auszustatten.“
Bayern habe sich hier weit aus der Deckung gewagt, kommentiert Dr. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die Maßnahmen. Dies sei genau der Gegensatz des Bestrebens, alles einheitlich zu machen. Man werde sehen, wie weit man damit komme. Wichtiger wäre aus seiner Sicht gewesen, dass Vertragsärzte von der Politik Unterstützung erfahren, statt Knüppel zwischen die Beine geworfen zu bekommen. Bayern sei hier wirklich „ein abschreckendes Beispiel“. KBV-Vize Dr. Stephan Hofmeister kritisiert einen „Rückfall in die Kleinstaaterei“.
Aus Sicht von Dr. Dirk Heinrich, Chef des NAV-Virchow-Bundes, sind solche Maßnahmen mit der Entmachtung der KV und der drohenden Zwangsverpflichtung von Vertragsärzten verbunden. Anstatt die eigenen staatlichen Verpflichtungen zu erfüllen, versuche der Freistaat mit einer Politik der Brechstange, Handlungsfähigkeit zu beweisen.
In seiner Funktion als Vorsitzender des Hartmannbundes ermahnt Dr. Klaus Reinhardt angesichts des bayerischen Vorstoßes die Regierungen aller Bundesländer, bei Gesetzesvorhaben im Zuge der Corona-Pandemie das Gebot der Verhältnismäßigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Zunächst müsse die Frage beantwortet werden, was genau an „Mehr“ man denn durch Zwangsmaßnahmen zu erreichen hoffe und was nicht auch gemeinsam in und mit der Selbstverwaltung geleistet werden könne.
Nach Bayern plant auch Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit von Zwangsmaßnahmen. Hier diskutierte vergangene Woche der Landtag das „Epidemie-Gesetz“. Laut Entwurf ist es ein „ein Regelwerk zur Bestimmung besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite“. Geplant ist, dass „medizinisches, pflegerisches oder sanitäres Material einschließlich der dazu gehörigen Rohstoffe sowie Geräte für die medizinische und pflegerische Versorgung“ sichergestellt werden kann.
Tiefpunkt politischer Krisenkommunikation
Zudem dürfen laut Gesetzentwurf Behörden im Krisenfall „von Personen, die zur Ausübung der Heilkunde befugt sind oder über eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege, im Rettungsdienst oder in einem anderen Gesundheitsberuf verfügen, die Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen verlangen“.
Für diese Ideen steht Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mächtig unter Druck. „Ich halte den Gesetzentwurf in der jetzigen Form in einigen Punkten für verfassungswidrig“, bemerkte der Rechtswissenschaftler Christoph Degenhart gegenüber der „Rheinischen Post“. Von einer verfassungsrechtlichen Sackgasse sprach auch die SPD-Opposition bei der ersten Lesung des Epidemie-Gesetzes. Einen „Tiefpunkt der politischen Krisenkommunikation“ und einen Eingriff in die Berufsfreiheit der Ärzteschaft sehen die Vorsitzenden des Hausärzteverbandes Nordrhein, Dr. Oliver Funken und Dr. Jens Wasserberg, darin.
Medical-Tribune-Bericht