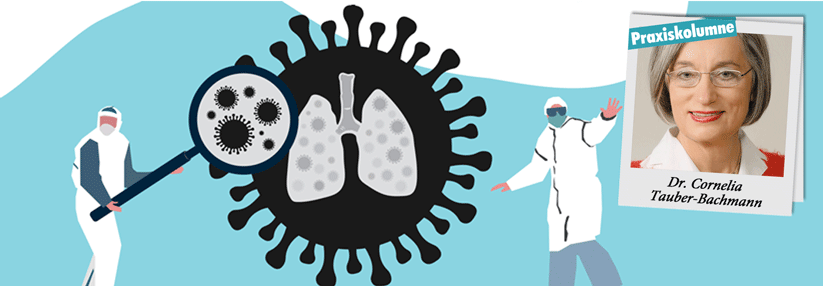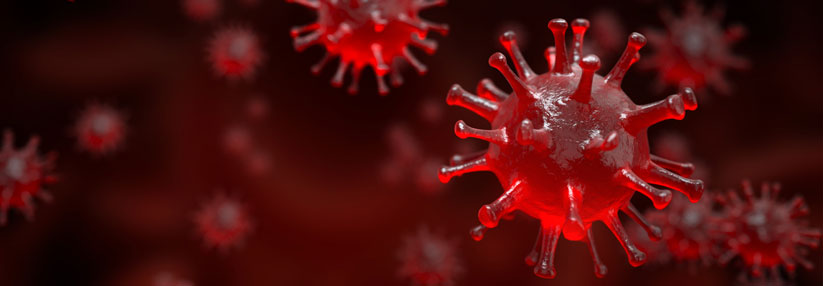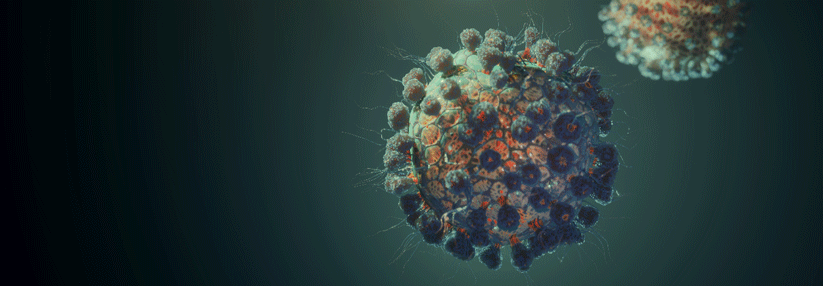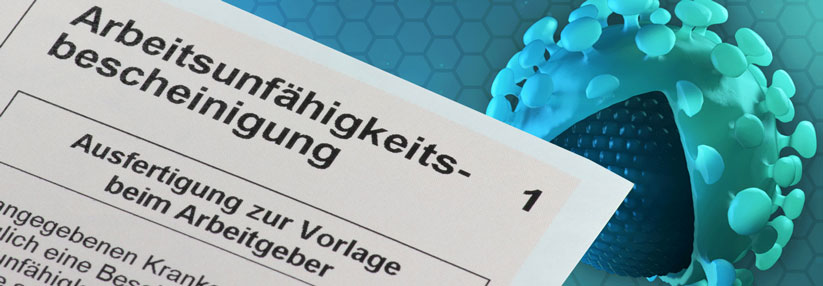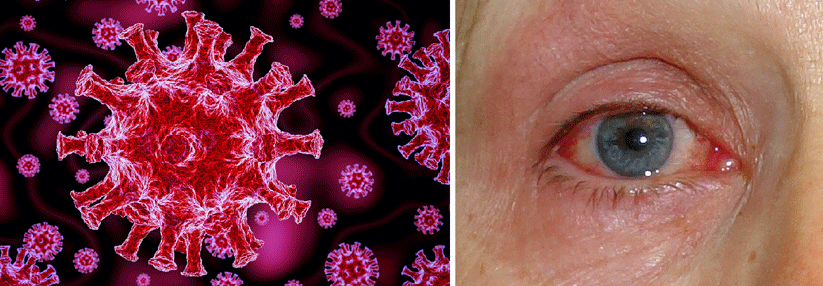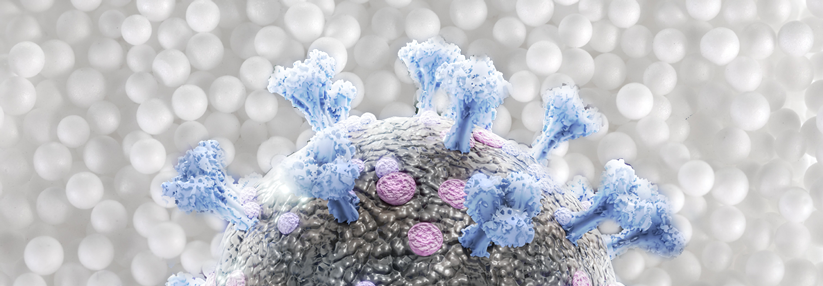Hausärzte an der Corona-Front: COVID-19-Sondereinsatz muss besser begleitet werden!
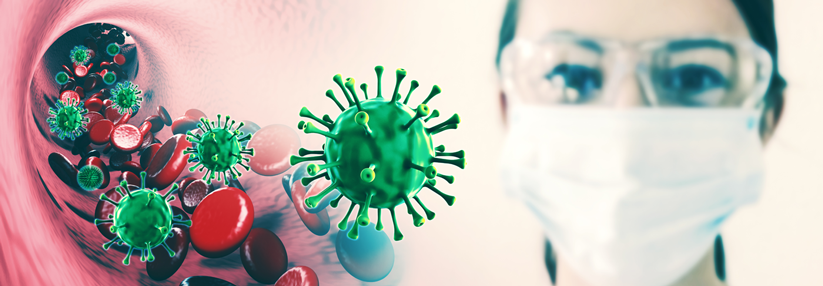 Hausärzte als Callcenter für 80 Millionen Einwohner – das ist kaum machbar. Wo bleibt die Unterstützung?
© Thomas Söllner – stock.adobe.com
Hausärzte als Callcenter für 80 Millionen Einwohner – das ist kaum machbar. Wo bleibt die Unterstützung?
© Thomas Söllner – stock.adobe.com
Bundesgesundheitsministerium (BMG), KBV und Ärztekammer haben aktuell eines gemeinsam: Sie stellen die rund 50 000 Hausärzte in Deutschland an die Spitze eines verworrenen Systems zur Eindämmung der anstehenden Pandemie durch das Coronavirus. So viel Vertrauen und Verantwortung ehrt uns. Was man bei diesem „Plan“ vergessen hat, ist die Frage, wie die Hausärzte, die bekanntlich besonders in ländlichen Regionen eine aussterbende Rasse darstellen, das bewerkstelligen sollen.
Hausärzte als Callcenter für 80 Millionen Einwohner – das ist kaum machbar
„Kontaktieren Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt per Telefon und besprechen Sie das weitere Vorgehen, bevor Sie in die Praxis gehen“, wird an vielen Stellen empfohlen. Wie aber dieses „Vorgehen“ aussehen soll, steht nirgends. Wenn die Hausarztpraxen bei einer weiteren Ausweitung der Pandemie als Callcenter für 80 Millionen Einwohner herhalten sollen, stößt das schon mathematisch an eine Grenze. Da hilft es auch nichts, wenn BMG und KBV weitere telefonische Anlaufstellen nennen. Die verweisen nämlich im Zweifel auch wieder nur auf den Hausarzt.
Aber vielleicht hat die KBV ja doch eine Lösung gefunden: Am 29. Februar schreibt sie, dass sich die Bevölkerung auf „die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in den 100 000 Praxen verlassen“ könne. Okay! Die Patienten können also auch Pathologen, Radiologen, Psychiater und Nuklearmediziner anrufen, wenn sie den Verdacht haben, von dem Virus befallen zu sein! Das beruhigt.
Zurück zum „weiteren Vorgehen“. Wenn ein besorgter Patient bei seinem Hausarzt anruft, weil er 39,9 Grad Körpertemperatur, starken Husten und einen Verwandten in Norditalien hat, der gerade zu Besuch war, was macht der Hausarzt? Bei begründetem Verdacht auf eine Infektion muss ein Virusnachweis erbracht werden. Der Hausarzt muss also zum Patienten fahren oder ihn zu einer „Infektionssprechstunde“ einbestellen.
Warum sollen denn wir die Schutzkleidung bezahlen?
Danach muss die Praxis desinfiziert werden, wozu der Arzt nach RKI-Empfehlungen Schutzmaske und Schutzkleidung braucht. Abgesehen davon, dass so etwas im Moment nicht oder nur zu Wucherpreisen zu bekommen ist, scheint es für die Verantwortlichen selbstverständlich zu sein, dass die Kosten dafür von den Praxen übernommen werden.
Aber jetzt hat Minister Jens Spahn das Problem endlich auch erkannt und erklärt, dass er sich um die Beschaffungslogistik kümmern will. Damit wäre also wenigstens der Weg des Hausarztes zum Patienten schon mal geebnet.
Aber dann? Nimmt der Arzt unter strengen Schutzvorkehrungen die Proben aus Rachen und Nase des Patienten, stellt sich nämlich die Frage: Wohin damit? Proben sollen schnellstmöglich nach Entnahme das Labor erreichen. Der Versand sollte gekühlt und über einen Paketdienst und nach Absprache mit dem Labor erfolgen. Das ist aber alles aktuell nicht flächendeckend geregelt – maximal punktuell in einzelnen Bundesländern. Dabei ist Deutschland mit Laborvereinen und -ärzten regelrecht übervölkert. Also warum ist es nicht möglich, über die sonst bestens organisierten Transportwege Testmaterial an Ort und Stelle zu bringen? Etwa, weil es ja auch die Gesundheitsämter gibt?
Ah ja, Stichwort Gesundheitsämter. Immerhin hat man es schnell geschafft, eine gesetzliche Regelung zu formulieren, wonach Infizierte oder Verdachtsfälle namentlich und umgehend dem Gesundheitsamt zu melden sind.
Gerade hier lauert aber eine größere Gefahr als die Infektion mit dem Virus selbst. Das Gesundheitsamt schickt nämlich Infizierte und Kontaktpersonen in Quarantäne. Zu den Kontaktpersonen zählt aber auch der Hausarzt, der einen Abstrich entnommen hat, der positiv ausfällt. Die Folge: Die Praxis wird vom Gesundheitsamt für mindestens zwei Wochen geschlossen. Und dem Praxisinhaber bricht der Praxisumsatz weg, während seine Kosten weiterlaufen.
Das kann eine Praxis in der Regel nicht einfach auffangen. Schon gar nicht, wenn es vielleicht zweimal in einem Quartal passiert. Umso schlimmer, wie die KVen das Problem angehen. Schließlich wird der Praxisinhaber hier in eine Notlage versetzt, weil er einen im Grunde genommen nicht zur vertragsärztlichen Tätigkeit gehörenden Versorgungsauftrag erfüllt.
In einem Rundschreiben weist die KBV lediglich darauf hin, dass Ärzte Anspruch auf Entschädigung haben, wenn der Praxisbetrieb aus infektionsschutzrechtlichen Gründen untersagt wird. Dabei verweist sie auf eine Liste zuständiger Behörden, an die sich Ärzte im Bedarfsfall wenden können.
Mal ehrlich: Es kann ja wohl nicht sein, dass man die Ärztinnen und Ärzte in vorderster Front derart allein lässt. Im Zusammenhang mit der Honorarreform zum 1. April hatte die KBV verkündet, dass Praxen bei einem nicht verschuldeten Umsatzverlust von mindestens 15 % Anspruch auf eine Ausgleichszahlung hätten. Aber Praxisinhaber, die Verluste durch eine Quarantäne erleiden, verweist man an Behörden!
Wenigstens der Laborbonus bleibt geschützt
Scheinbar hat die KBV das Prinzip der Honorarverteilung in der vertragsärztlichen Versorgung nicht mehr in Erinnerung. Die Kassen leisten bekanntlich eine Gesamtvergütung mit befreiender Wirkung. Dieses Geld wird über den regionalen Honorarverteilungsmaßstab verteilt. Fällt ein Leistungserbringer aus, bleibt das Geld im Topf zur weiteren Verteilung.
Korrekt wäre deshalb, eine Härtefallregelung zu schaffen, die betroffene Praxen unbürokratisch zum Beispiel auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses entschädigt. Immerhin muss die Gesamtvergütung des Folgejahres auch um eine solche unvorhersehbare Entwicklung entsprechend angehoben werden. Einen Behördenausgleich könnten die KVen dann auch selbst veranlassen. An Personal mangelt es den KVen wohl nicht!
Immerhin hat es die KBV geschafft, dass die Mehrarbeit im Rahmen der Pandemie vergütet wird. Nach einem Beschluss des Bewertungsausschusses vom 28. Februar werden die Leistungen, die im Zusammenhang mit einer Infektion oder auch nur dem Verdacht auf eine Infektion anfallen, extrabudgetär vergütet. Die Fälle müssen mit der Pseudonummer 88240 gekennzeichnet werden. Vergessen sollte man dabei auch nicht den Ansatz der Laborkennziffer 32006, damit der Laborbonus nicht mit den Kosten für den Test belastet wird.
Kastanien aus dem Feuer holen? Nur mit Werkzeug!
Die Berufsverbände verhalten sich ansonsten angesichts der Gemengelage verblüffend ruhig. Insbesondere die Vertretung der Hausärzte müsste viel lauter auf Missstände hinweisen. Der Hausärzteverband ist schließlich nicht nur politisch, sondern über die HÄVG auch finanziell betroffen. Denn der zusätzliche Einsatz der Hausärzte fällt mit den HzV-Pauschalen in den Ziffernkranz.
Mein Fazit
Medical-Tribune-Bericht