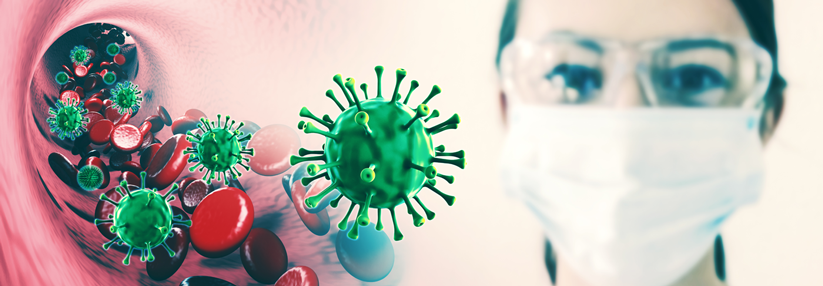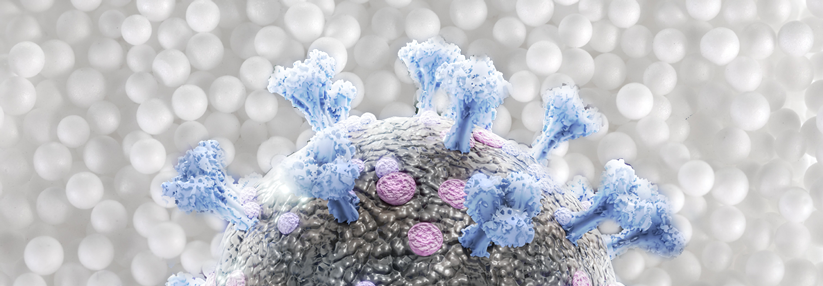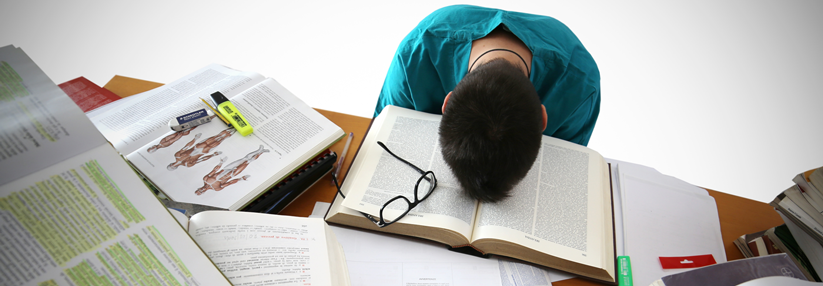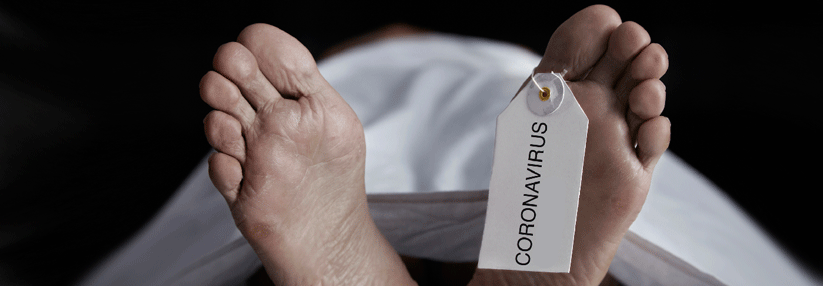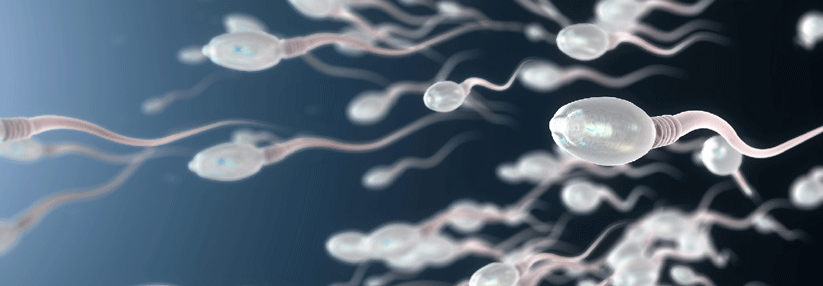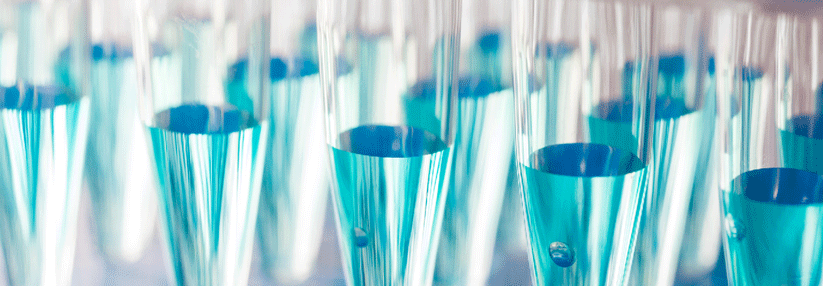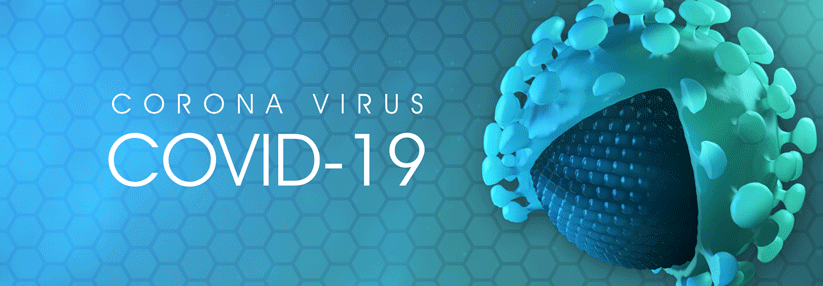
Corona-Krise: Helfer und Einrichtungen finden noch nicht gut zusammen
 Für Tests auf das Coronavirus – wie hier im Drive-In in Baden-Württemberg – werden Mediziner benötigt.
© Jürgen Fälchle – stock.adobe.com
Für Tests auf das Coronavirus – wie hier im Drive-In in Baden-Württemberg – werden Mediziner benötigt.
© Jürgen Fälchle – stock.adobe.com
„Das Robert Koch-Institut hat 500 Stellen für Unterstützungspersonal im Krisenmanagement geschaffen und sucht vor allem Studentinnen und Studenten“, meldete das Bundesgesundheitsministerium am 23. März. Kurz danach ließ es auf Twitter verlauten: „Das @rki_de hat 10 000 Bewerbungen erhalten. Danke, dass so viele mithelfen wollen. Wenn neue Stellen geschaffen werden, finden Sie diese beim Robert Koch-Institut und bei uns.“
Geht man auf die Bewerbungswebseite beim Bundesverwaltungsamt, wird klargestellt, dass bei dem immensen Bewerbungsaufkommen keine weiteren Bewerbungen berücksichtigt werden können. „Wir bitten um Verständnis.“
Der Bedarf an medizinischem Personal ist riesig
Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt hatte am 20. März in einem Videoappell Ärzte im Ruhestand und Medizinstudierende zur Mithilfe im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen: „Wir sind für jede helfende Hand dankbar.“
Auch regional werden Mitstreiter gesucht. Beispielsweise hält die KV Hessen Ausschau nach Ärzten und Personal, das auf freiwilliger Basis für Testzentren arbeitet. Und die Berliner Krankenhausgesellschaft hat sich „an alle Berlinerinnen und Berliner mit medizinischer Ausbildung“ gewandt und um Unterstützung gebeten, um den hohen Bedarf an Fachkräften für die Versorgung von COVID-19-Patienten in den Kliniken zu gewährleisten. In Sachsen könnten Ärzte im Ruhestand eine telefonische Beratung risikolos übernehmen. Und Medizinstudenten nach dem Physikum seien sehr gut geeignet, um Ärzte und Gesundheitsämter bei Abstrichen und der Ermittlung von Kontaktpersonen zu unterstützen, schreibt die Sächsische Landesärztekammer.
Theoretisch ist also alles klar. Der Bedarf ist da bzw. wird da sein. Aber praktisch scheint es nicht überall zu gelingen, entsprechendes Personal für den Ernstfall einzubinden.
Neue Plattform bringt Helfer an den richtigen Ort
Zu viele Angebote, um schnell reagieren zu können?
Die willigen Kollegen decken diverse Fachgebiete ab, u.a. Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Psychiatrie/Neurologie, Chirurgie. Dr. Schulze hat wie einige ihrer Mitarbeiter auf Intensivstationen gearbeitet. „Wir sind aber schon einige Zeit raus, deshalb wäre es gut, wenn wir uns vor dem großen Ansturm noch einarbeiten lassen könnten“, sagt sie. Geschäftsführer Eik Schulze hat bereits Mitte März diverse E-Mails verschickt, in denen er die Hilfe des Instituts anbot, über einen Lösungsweg, „der unbürokratisch und praktikabel ist“. Adressaten waren die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, das Bundesgesundheitsministerium, die KV Berlin, hauptstädtische Gesundheitsämter sowie ca. 25 Krankenhäuser. „Ich habe mich bei den Einrichtungen gemeldet, teilweise mehrfach per E-Mail und per Telefon“, so der Geschäftsführer. Überwiegend habe er keine Rückmeldung erhalten. Ein großes Krankenhaus habe angeboten, die Kollegen bei sich anzustellen. Er solle die Unterlagen schicken. „Das sind aber unsere Mitarbeiter und wir wollen sie auch behalten“, empört sich Schulze. Ein anderes großes Krankenhaus forderte ihn auf, seine nervenden Nachfragen umgehend einzustellen. Die Antwort der Senatsverwaltung lautete: „Momentan bekommen wir, wie Sie sich sicher denken können, eine Menge Angebote zugesandt, die wir prüfen werden. Bitte haben Sie etwas Geduld, wenn wir nicht gleich darauf reagieren können.“Kammerchef: Bald wird jede verfügbare Kraft gebraucht
Ähnliche Erfahrungen hat der Anästhesiologe Jan-Peter Jansen gemacht. Der Leiter des Schmerzzentrums Berlin und Ärztliche Direktor der angeschlossenen Schmerzklinik Berlin berichtet Medical Tribune: „Die Klinik steht jetzt leer. Wir haben uns verhalten wie vom Senat empfohlen und uns dem Pandemie-Stab als Reserve gemeldet. Aber wir sind nicht im Entschädigungsplan, wir sind im Blindflug.“ Verstehen kann man dies allerdings nicht, denn laut Berliner KV sind die Intensiv- und Beatmungskapazitäten in der Hauptstadt bereits überbelegt und weitere werden gebraucht.So läuft Personaleinsatz à la Bundeswehr in der Krise
Medical-Tribune-Bericht