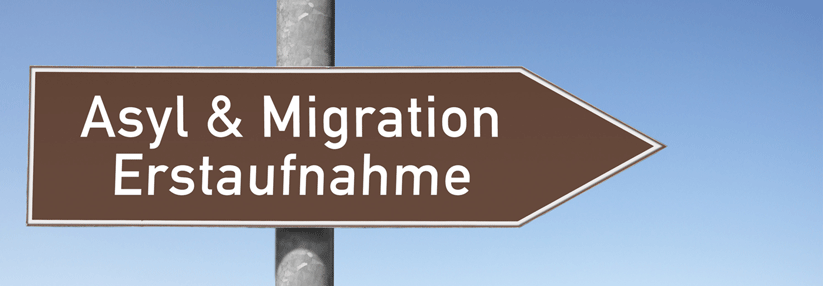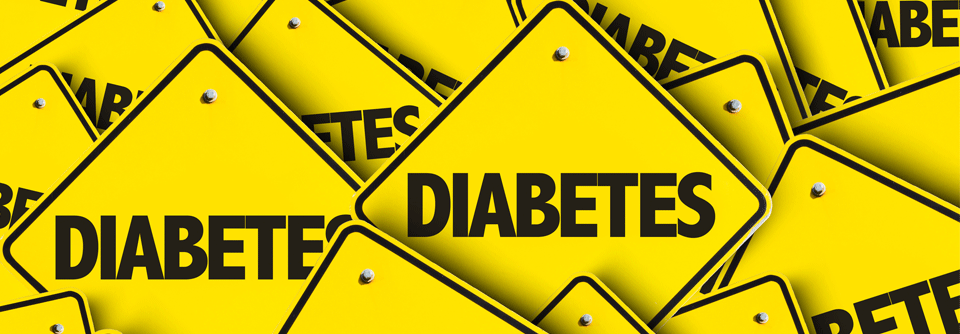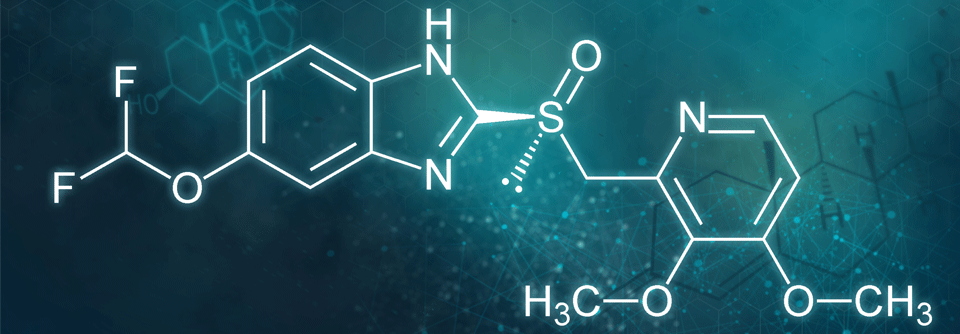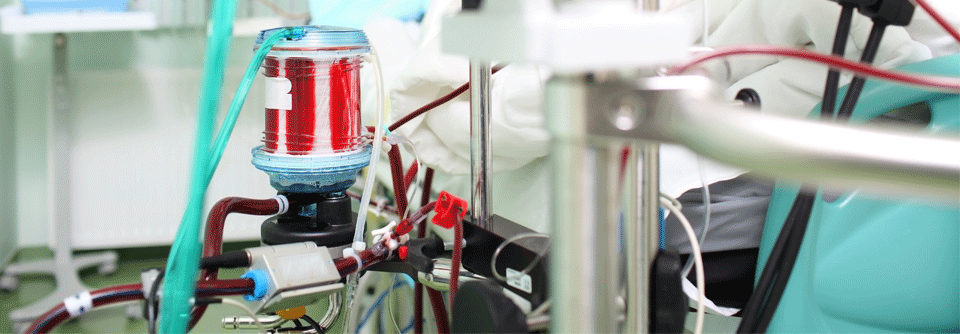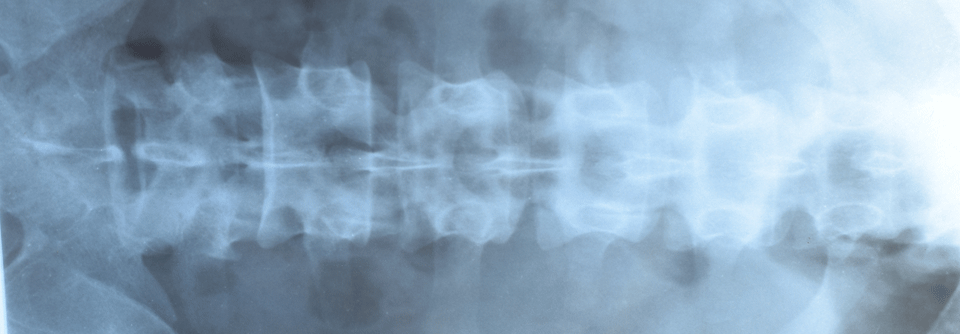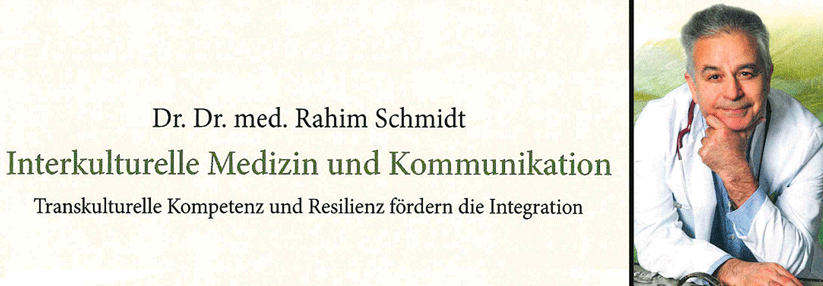
Patienten mit Migrationshintergrund besser verstehen und Missverständnisse vermeiden
 Transkulturelle Kompetenz bereichert den Praxisalltag. (Agenturfoto)
© iStock/FatCamera
Transkulturelle Kompetenz bereichert den Praxisalltag. (Agenturfoto)
© iStock/FatCamera
Nicht immer mag es nachvollziehbar sein, warum manche Patienten mit Migrationshintergrund mit der ganzen Familie in der Praxis erscheinen. Es gehe aber nicht darum, ein Verhalten als richtig oder falsch zu beurteilen. Stattdessen müsse man versuchen, es als Ressource zu nutzen, erklärte Dr. Dr. Rahim Schmidt aus Mainz auf dem 127. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Sein Ziel sind positive Dialoge und transkulturelle Kompetenz. „Wir sind keine Mechaniker, sondern Therapeuten“, betonte der im Iran geborene Allgemeinmediziner.
Bei orientalischen Gesellschaften handele es sich oft nicht um Individual-, sondern um Familiengesellschaften, gab er zu bedenken. Daraus würden sich im Umgang mit Erkrankungen Unterschiede ergeben.
„Ist ein Familienmitglied krank, fühlt sich die ganze Familie mit im Boot“, erläuterte Dr. Schmidt zum Beispiel die Begleitung eines Patienten von mehreren Angehörigen. Das zeuge von einem starken Zusammenhalt, der bei der Krankheitsbewältigung helfe und z.B. präventiv gegen Depression wirke. Man könne darauf wertschätzend reagieren. „Ich begrüße alle kurz herzlich und erkundige mich, wer krank ist“, so der Mediziner. Er dankt den Angehörigen ausdrücklich für das Begleiten und betont, wie sehr er das begrüßt. Dann bittet er die Angehörigen ins Wartezimmer bzw. nach Hause zu gehen.
Menschen seien umso mehr aufeinander angewiesen, je weniger gut die Versorgung in ihrem Land ausgebaut sei. In der Gesellschaft interagiere man dann stärker auf der Beziehungsebene und wer erkranke, müsse auch durch „Jammern“ und Laute auf sich aufmerksam machen, damit sich jemand um ihn kümmert. Dies sei ein Grund dafür, dass manche Patienten hierzulande z.B. als wehleidig wahrgenommen würden. Vorurteilsbehaftete Begriffe wie „Mamma-mia-Syndrom“ hätten an dieser Stelle aber nichts zu suchen.
Schilderung nicht anatomisch präzise, sondern ganzheitlich
Patienten mit Migrationshintergrund würden ihre Beschwerden auch nicht immer so präzise beschreiben, wie hiesige Ärzte sich das wünschen, stellte Dr. Schmidt weiter fest. Oft heiße es schlicht: „Ich bin krank.“ In autoritären Regimen wie dem Iran passe sich die Sprache zudem den politischen Verhältnissen an. Aussagen würden dann oft zweideutig, indirekt und verallgemeinernd getroffen.
Auch die symbolische Aufladung bestimmter Organe könne kulturell differieren. So würden emotionale Leiden in manchen Ländern auf die Leber projiziert, hierzulande dagegen eher aufs Herz. Einheimische würden daher häufiger wegen angina-pectoris-ähnlicher Symptome behandelt.
Dr. Schmidt schlägt vor, die transkulturelle Kompetenz im Studium zu verankern. „Sie erleichtert die Teamarbeit und verbessert die Kritik- und Fehlerkultur.“ Man benötige daher Institute für interkulturelle Medizin. Zudem könne man telemedizinisch zur Ausbildung der Ärzte in anderen Staaten beitragen. „Das wäre für mich ein Stück Friedensarbeit“, bekräftigte Dr. Schmidt.
Kongressbericht: 127. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (Online-Veranstaltung)